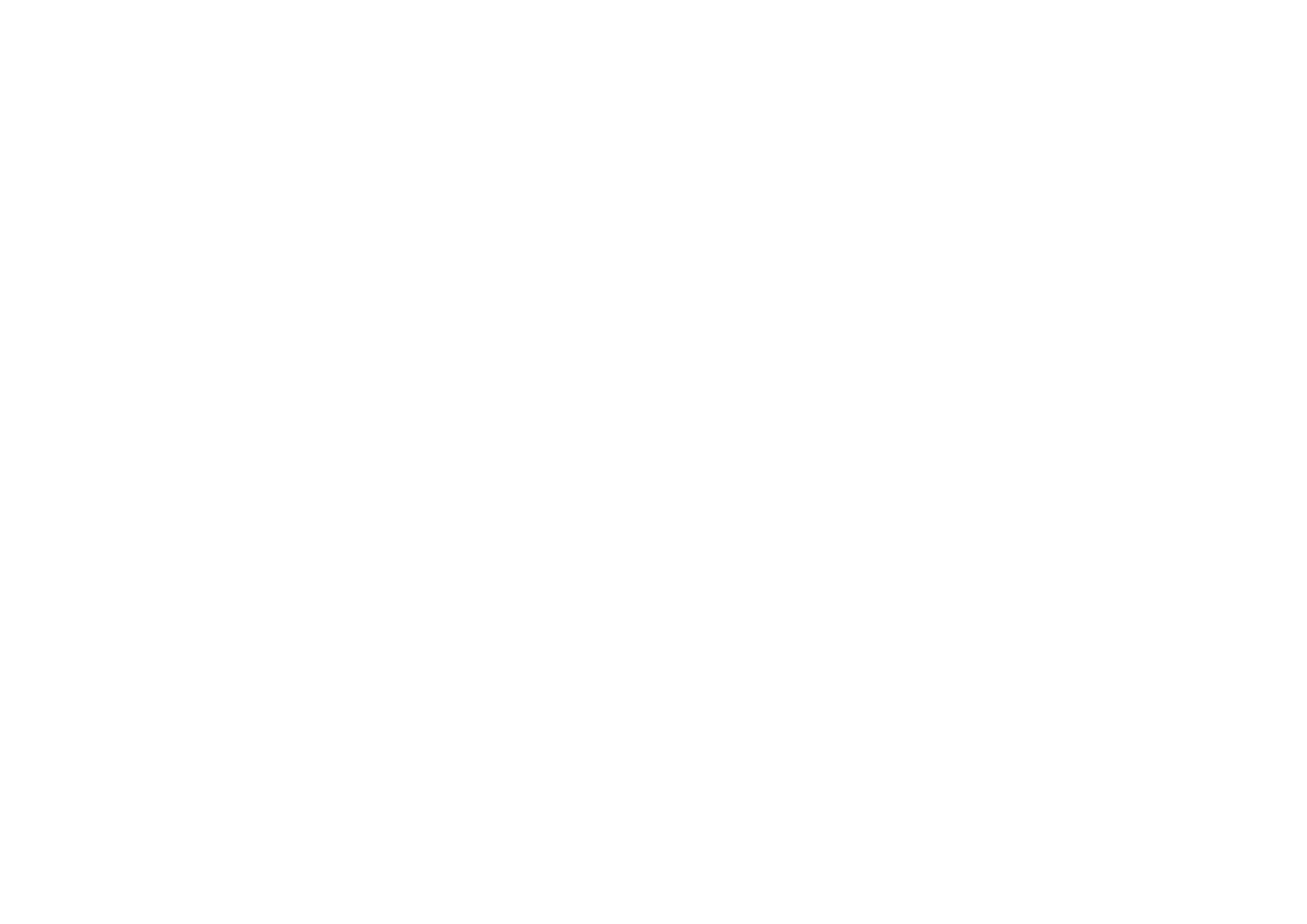
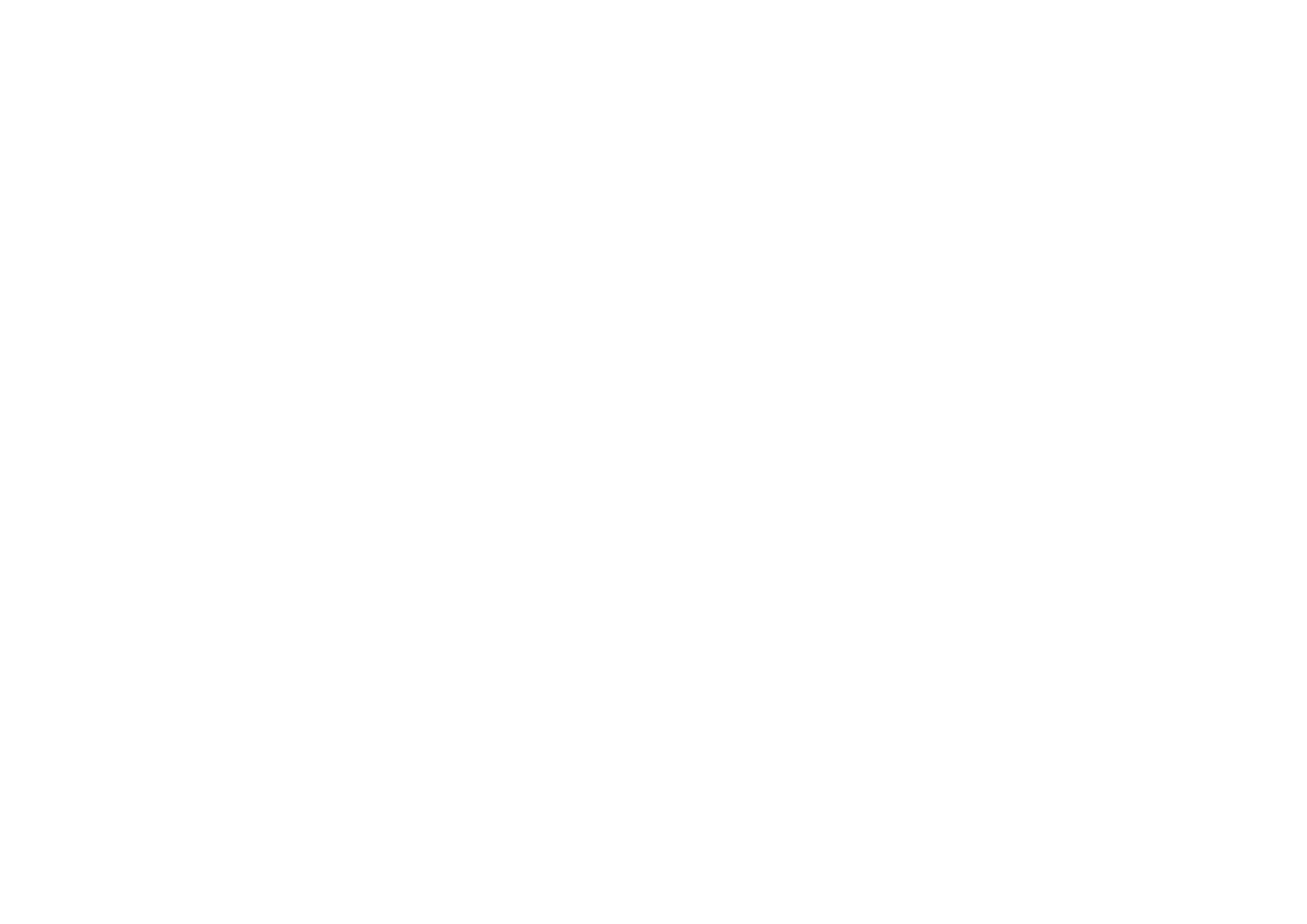
A2
In diesem Jahr haben wir das 50. Jubiläum der Juso-Linkswende gefeiert. Kaum ein anderes Ereignis hat das qualitative Gedächtnisschicksalshaften Münchener Bundeskongress. Auf diesem hat eine Generation von politisch Aktiven die Weichen für einen Prozess gestellt, den wir bis heute al dauernden Auftrag empfinden: Uns immer wieder mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wir Jusos unser Verständnis von Sozialismus, Feminismus, Antifaschismus und Internationalismus angesichts sich permanent wandelnder politischer, gesellschaftlicher und ökonomischer Verhältnisse fassen und in konkrete Politik ummünzen. Gerade in diesem Jahr scheint dies aus unserer Perspektive in besonderem Maße notwendig geworden zu sein. Nicht nur, weil wir das eingangs erwähnte Jubiläum feiern. Sondern vor allem aufgrund der stürmischen Krisen der deutschen und europäischen Sozialdemokratie. Sie machen es auch für uns Jusos erforderlich, unsere eigenen Positionen zu klären, den Kompass zu justieren und unser Verständnis der konkreten Utopie einer Gesellschaft der Freien und Gleichen zu schärfen. Dieses Programm ist der Versuch, grundlegende Diskussionen und Positionen unseres Verbandes zusammenzufassen, dort, wo es notwendig ist, weiterzuentwickeln und zu konturieren. Allein die Menge der zusammengetragenen Positionen ist Ausdruck eines lebendigen und stets auf programmatische Arbeit fokussierten Verbandes. Sie spiegeln das Engagement mehrerer Juso-Generationen wider und haben den Anspruch, ein möglichst vollständiges Bild davon zu zeichnen, wo wir als Verband kurz vor Anbruch der Zwanzigerjahre unseres Jahrtausends stehen
Wir Jusos richten unser politisches Handeln nach den Maßstäben von Freiheit, Gleichheit und Solidarität aus. Die Politik, für die wir kämpfen, ist demokratisch und sozialistisch. Doch der Weg in die Gesellschaft der Freien und Gleichen ist noch ein langer -in Deutschland, Europa und weltweit! Deshalb kämpfen wir nicht allein. Wir sind Teil der gesellschaftlichen und internationalen Linken und der SPD in kritischer Solidarität verbunden. Aus der langen Geschichte unseres Verbandes wissen wir, dass ohne die Gleichzeitigkeit aus emanzipatorischer Bewegung und Sozialdemokratie kaum Fortschritt möglich ist. Dieses Potenzial zu entfalten, indem wir linke Politik-und Gesellschaftsentwurfe sowohl innerhalb der Sozialdemokratie, als auch gemeinsam mit unseren Bündnispartner*innen entwickeln und zusammen durchzusetzen versuchen, ist ein zentraler Bestandteil unseres Handelns.
Wir wollen die Gesellschaft der Freien und Gleichen. Sie verbindet sozialen, ökologischen und ökonomischen Fortschritt mit der freien Entwicklung und Entfaltung aller auf Basis ökonomischer Sicherheit. Die Überwindung kapitalistischer Produktionsverhältnisse sowie die Humanisierung der Erwerbsarbeit sind für das Erreichen dieser Ziele zentral. Patriarchat, Zwang, Ausbeutung, Unterdrückung und jede Form der Menschenfeindlichkeit bedeuten Unfreiheit. Unfreiheit steht der gerechten Gesellschaft entgegen und ist mit ihr nicht vereinbar. In der gerechten Gesellschaft ist gleiche Teilhabe an Wohlstand und gleicher Zugang zu gesellschaftlicher Macht gewährleistet; Geschlecht, Herkunft, soziale Stellung und individuelle Vorlieben gereichen dabei niemandem zum Nachteil. Die gerechte Gesellschaft steht allen offen. Auch sorgt diese Gesellschaft für Teilhabe auf allen Ebenen für Menschen mit Behinderung, sodass sie in ihrem Leben und Bestreben nicht mehr beeinträchtigt werden. Als Internationalistinnen streben wir sie weder aus altruistischen, noch aus egoistischen Motiven an, sondern aus der Erkenntnis heraus, dass nur durch eine internationale 36Arbeiterinnenjugendbewegung und wechselseitige Solidarität die Strukturen des globalisierten Kapitalismus überwunden werden können, welche Ungleichheiten stets reproduzieren. Unsere gerechte Gesellschaft kennt folglich keine Grenzen. Das Streben hin zu einer derartigen Gesellschaft begreifen wir als Demokratischen Sozialismus.
In diesen Zeiten, in denen sich neue Entwicklungen, Umwälzungen und Megatrends in immer schnellerer Folge verdichten und von vielen Menschen kaum noch nachvollzogen werden können, braucht es eine politische Linke, die ohne Hass und Angst Interpretationen und Lösungen anbietet. Eine Linke, die greifbar macht, dass Teilhabe am globalen Wohlstand, an Frieden und Sicherheit allen zustehen und nur dann Wirklichkeit werden, wenn Menschen ihre Wut nicht gegeneinander, sondern vielmehr gegen die Ursachen dieser Zustände richten. Eine Linke, die bereit ist nicht mehr nur Symptome zu bekämpfen, sondern sich endlich wieder über die offensichtlichen Missstände unserer Gesellschaft empört und Lösungsansätze bereitstellt. Eine Linke, die an der Seite von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und den von Ungleichheit Betroffenen gegen Armut, Ausbeutung, Demütigung und Verwertungslogik kämpft. Eine Linke, die den langjährigen Klassenkampf von oben mutig annimmt und demokratischen Widerstand organisiert und anführt. Eine Linke, die sich dem Raubbau an unserem Planeten mutig und entschieden entgegenstellt. Eine solche Linke muss zahlreiche Aufgaben bewältigen: Erstens muss sie ihre weitgehend beschreibende Sicht auf die Verhältnisse erweitern und wieder bereit sein, neue gesellschaftliche Mehrheiten im Diskurs zu erkämpfen. Wenn der Zeitgeist rechts ist, dann kann die Antwort nicht die Orientierung am Zeitgeist sein, sondern immer nur seine Änderung. Zweitens muss sie neben der Umwälzung der Verhältnisse nach den Maßstäben ihrer Grundwerte auch willens und in der Lage sein, einen eigenständigen und positiven Entwurf der Zukunft zu zeichnen. Die Sozialdemokratie ist eine zukunftsbejahende Bewegung. Ihre Erzählung fußte immer auf der Idee, dass die Zukunft etwas Besseres bringen würde, als das Hier und Jetzt. Real existierende Zukunftsängste sind nicht etwa ein Grund diesen Anspruch aufzugeben, sondern vielmehr die Verpflichtung, die eigenen Anstrengungen zu intensivieren und damit die Voraussetzungen linker Politik neu zu ordnen. Die Sozialdemokratie ist auch international vielerorts in der Defensive, mancherorts sogar gänzlich vom Erdboden verschluckt worden. Diesem Umstand müssen wir uns stellen und zum Handeln drängen, denn mit der organisierten Sozialdemokratie verschwinden in aller Regel auch die Aussichten auf Mehrheiten für linke Politik, was Hoffnungsund Perspektivlosigkeit in diejenigen Kreise einsickern lässt, die wir so dringend an unserer Seite brauchen. In einer Welt, die von globalen Ungerechtigkeitsstrukturen geprägt ist, sind viele politische Antworten notwendigerweise international zu geben. Niederlagen und Orientierungslosigkeit unserer Mutter-und Schwesterparteien sowie die Fragmentierung unserer einstmals starken internationalen Zusammenschlüsse, sind daher auch unsere Niederlage. Die deutsche Sozialdemokratie muss ein existenzielles Interesse an der Stärkung ihrer globalen Familie haben. Nicht in Form eines gemütlichen Lagerfeuers der Selbstbeschäftigung, sondern als schlagkräftige Verbundstruktur, in der globale Gerechtigkeitsfragen diskutiert, beantwortet und in politische Strategie überführt werden.
Doch die SPD selbst ist in einer besorgniserregenden Verfassung, die niemanden, derdie es mit der Sozialdemokratie gut meint, kalt lassen kann. Seit 1998 hat sie 16 Jahre lang in unterschiedlichen Konstellationen die Bundesregierung gestellt. Während annähernd desselben Zeitraumes hat sich die Wählerinnenschaft der SPD halbiert. Zugleich hat sie ca. 300.000 Mitglieder verloren. Mittlerweile hat die SPD in den meisten Teilen Deutschlands nicht einmal mehr die Aussicht, zweitstärkste Kraft zu werden, sondern rangiert weit abgeschlagen hinter CDU/CSU und den Grünen. In sechs von 16 Bundesländern hat die SPD überhaupt kein Direktmandat bei der Bundestagswahl gewinnen können, in vieren jeweils nur eines. Besorgniserregend ist auch die Verankerung der SPD in unterschiedlichen Wähler*innengruppen. Ihre Wahlergebnisse ähneln sich quer durch alle Milieus, Altersgruppen und Berufsstände. Was auf den ersten Blick nach Stärke durch Vielfalt ausschauen mag, ist bei näherer Betrachtung Teil des Problems: Wer alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen anspricht, dem mangelt es erkennbar an Profil. Offenkundig fühlt sich kein bestimmtes Klientel oder Milieu in besonderer Weise von der Sozialdemokratie vertreten. Für eine Programmpartei ist dies ein unhaltbarer Zustand.
Als ausschlaggebend kann die anhaltende mangelnde inhaltliche Polarisierung zwischen den politischen Lagern angesehen werden. Die Wahl zwischen SPD und Union ließ sich vielfach nicht anhand politischer Lagerzugehörigkeit, sondern höchstens an einzelnen Sachfragen festmachen. Dieser Effekt wurde zudem durch die absehbar möglichen Regierungskonstellationen verstärkt. Mit dem erneuten faktischen Ausschluss einer rot-rot-grünen Koalition war die Große Koalition zuletzt für die SPD die einzige realistische Option, an der Regierung beteiligt zu sein. Es war daher im Wahlkampf schwer vermittelbar, dass sich die SPD nach der Wahl von der Union abgrenzen und eine progressive Regierungskoalition würde bilden können. Diese mangelnden Optionen jenseits der Großen Koalition prägen die Bundestagswahlkämpfe seit 2009 und haben stark zum Eindruck beigetragen, dass die SPD keine ernsthafte Perspektive für ein linkes Regierungsprojekt darstellen konnte. Der Höhenflug der SPD im Frühjahr 2017 gründete sich auf der Annahme, dass neues Personal in Verbindung mit einer zumindest vermuteten politischen Kurskorrektur ein Politikangebot bilden würden, welches es wert sein könnte mit einem stärkeren politischen Mandat ausgestattet zu werden. Stattdessen wurde die SPD am 24. September aber – wie auch schon bei vorangegangenen Wahlen – hauptsächlich wegen ihrer Sachlösungskompetenz gewählt. Die politischen Instrumente und Forderungen im Wahlprogramm der SPD stießen ganz überwiegend auf Zustimmung. Doch auch wenn deutlich war, dass eine Mehrheit der SPD-Wählerinnen die meisten politischen Forderungen der SPD für richtig hielt, konnten paradoxerweise zugleich vier aus fünf von ihnen nicht sagen, wie die von der SPD geforderte soziale Gerechtigkeit grundsätzlich zu verstehen sei. Dieser widersprüchliche Befund führt zu der Folgerung, dass es der SPD nicht an politischen Lösungsvorschlägen für Einzelprobleme, sondern an einem politischen Gesamtkonzept mangelt. Der letzte mehr oder weniger umfassende Gesellschaftsentwurf, den die SPD präsentieren konnte, war das rot-grüne Regierungsprojekt von 1998-2005, das im Hamburger Grundsatzprogramm der SPD von 2007 weitgehend seine Entsprechung gefunden hat und welches heute insbesondere mit der sich am neoliberalen Zeitgeist orientierenden Agenda-Politik verknüpft wird. Seit 2005 sind es vor allem Veränderungen jener Agenda-Politik, mit denen sich die SPD hervorgetan hat; die innerparteiliche Diskussion dreht sich dabei meist – ob positiv Bezug nehmend oder in Kritik distanzierend – um diesen Teil des rot-grünen Erbes. Dabei ist die Zeit reif, einen neuen Gesellschaftsentwurf zu präsentieren. Weltweit finden tiefgreifende Umbrüche und gesellschaftliche Umwälzungen statt. Sie führen häufig zu Verunsicherungen und wecken bei Menschen das Bedürfnis, sich an Bekanntem festzuhalten. Gleichzeitig bieten diese gesellschaftlichen Umwälzungen – und vor allem die ihnen zugrundeliegenden Fortschritte– die Möglichkeit, unsere Gesellschaft grundlegend zu verändern und fortschrittlicher, das heißt freier und gerechter zu gestalten. Es wäre an der Sozialdemokratie, den Gesellschaftsentwurf für ein überfälliges, umfassendes und neues Fortschrittsprojekt zu formulieren. Die Sozialdemokratie war stets der politische Nährboden für jeden umfassenden gesellschaftlichen Fortschritt – sie ist die Partei des Fortschritts. Als solche streitet sie zugleich für die Gerechtigkeit. Sie vertritt die Interessen derjenigen, die unter den bestehenden Verhältnissen keine Gerechtigkeit erfahren und den besagten Fortschritt somit als individuelle oder kollektive Bedrohung erleben. Sie streitet für die Menschen, die nicht erhalten, was ihnen zusteht. Sie streitet für diejenigen, die unter diesen Verhältnissen leiden oder unfrei in ihnen sind. Doch die Versöhnung von Fortschritt und Gerechtigkeit unter eben diesen Prämissen würde voraussetzen, dass die SPD wieder spürbar parteiisch agiert. Eine Neuauflage dessen, was in der Sozialdemokratie lange Zeit als Klassenstandpunkt firmierte, ist folglich dringend angezeigt. Es geht um die unmissverständliche Positionierung an der Seite der abhängig Beschäftigten, der Marginalisierten und der solidarischen Mehrheit. Ohne die deutlich vernehmbare Skandalisierung herrschender Ungerechtigkeiten wird dies nicht gelingen. Dafür muss auch ein für alle Mal Schluss sein mit demoskopiegetriebenen Politikansätzen. Verschärfungen des Asylrechts, der Verzicht auf substanzielle Vermögensbesteuerung oder auch eine restriktivere Innen-und Sicherheitspolitik sind beispielhafte Eckpfeiler einer Politik, die ihren emanzipatorischen Anspruch portionsweise über Bord wirft. Geben wir den Anspruch auf, Stimmungen in unserem Sinne zu verändern und laufen wir ihnen stattdessen hinterher, so verwirken wir mittelfristig unsere Daseinsberechtigung als progressive politische Kraft. Außerdem verspielen wir so die Chance, potenzielle Bündnispartnerinnen von Gewerkschaften bis zur organisierten Zivilgesellschaft eng an uns zu binden, die auf verlässliche politische Partner*innen dringend angewiesen sind.
Wir Jungsozialistinnen sind seit unserer Gründung als Interessenorganisation von „Lehrlingen“ Teil der Sozialdemokratie und Teil der Arbeiterinnenjugendbewegung. Deswegen ist uns der gemeinsame Kampf mit den Vereinigungen, die aus der Arbeiterinnenjugendbewegung entsprungen sind, bis heute besonders wichtig. Insbesondere der gemeinsame Kampf mit den Gewerkschaften prägte und prägt bis heute unsere Arbeit. Sie gehören auch in Zukunft zu unseren wichtigsten Bündnispartnerinnen. Nach einer Phase der Entfremdung, die durch die neoliberale Politik der Agenda 2010 ausgelöst wurde, konnte zwar in den letzten Jahren wieder eine Annäherung zwischen Gewerkschaften und Sozialdemokratie und im Besonderen auch zwischen Jusos und Gewerkschaftsjugenden beobachtet werden. Das einigende Band zwischen Sozialdemokratie und Gewerkschaftsbewegung muss in den nächsten Jahren aber noch enger geknüpft werden, um den Kampf gegen die Auswüchse des Kapitalismus und für dessen Überwindung führen zu können. Daran werden wir auf allen Ebenen unseres Verbandes und der Partei arbeiten. Auch deshalb setzen wir uns dafür ein, die Sozialdemokratie als moderne Partei der Arbeit zu positionieren!
Der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit besteht auch in der digitalisierten Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts fort und führt weiterhin zu Ausbeutung, Armut und Kriegen. Arbeit und die Auflösung dieses Widerspruches stehen deshalb im Mittelpunkt unserer Programmatik.
Eine Gesellschaft der Freien und Gleichen setzt aus unserer Perspektive voraus, dass alle Bereiche des Lebens demokratisiert werden. Die Arbeits-und Wirtschaftswelt ist in diese Forderung eingeschlossen. Wir wollen bisherige demokratische Strukturen in Betrieben und öffentlichen Einrichtungen erhalten und stärken. Wir setzen uns dafür ein, dass die Einflussmöglichkeiten von Personal-und Betriebsräten sowie Jugend-und Auszubildendenvertretungen erweitert werden, und wollen die Gründung von Betriebsräten erleichtern. In Betrieben, in denen kein Betriebsrat existiert, soll trotzdem die Möglichkeit bestehen, JAVen zu gründen. Durch Unternehmensumstrukturierungen und Standortkonkurrenz ist die Weiterentwicklung der europäischen und internationalen Mitbestimmung unumgänglich. Die Beteiligungsrechte der Arbeitnehmerinnen müssen über die nationalen Grenzen hinaus ausgebaut werden, um dem global agierenden Kapitalismus zu begegnen und erfolgreich eine betriebliche und überbetriebliche Interessensvertretung gewährleisten zu können Dies sind aus unserer Perspektive aber nur erste Schritte: Um die Wirtschaft weiter zu demokratisieren und gerechter zu gestalten, fordern wir, dass Mitarbeiterinnen auch an allen unternehmerischen Entscheidungen im Betrieb mitwirken. Betriebliche Mitbestimmung muss daher auch unternehmerische Mitbestimmung einschließen. unternehmerische Mitbestimmung einschließen“: „Im ersten Schritt muss die echte Parität, wie sie beispielsweise schon im Montanmitbestimmungsgesetz festgeschrieben ist, auf sämtliche Unternehmen ausgeweitet werden, um die Machtverhältnisse zu Gunsten der Arbeitnehmerinnen zu verschieben. Schließlich muss die Ausweitung der unternehmerischen Mitbestimmung in letzter Konsequenz dazu übergehen, die Organisation und Ausrichtung des Unternehmens gänzlich in die Hände der Beschäftigten zu übertragen. Anders als Managerinnen und kapitalistische Unternehmenseigentümer*innen haben die Beschäftigten in den meisten Fällen nicht nur den Profit ihres Unternehmens als obersten Zweck im Auge, sondern auch andere gesellschaftliche Ziele. Wir können es uns nicht länger leisten, dieses Potential ungenutzt zu lassen. Wir streben daher die schrittweise und gemeinwohlorientierte Vergesellschaftung von Produktionsmitteln an und wollen unsere gemeinsame Produktion demokratisch und sozialistisch organisieren.
In den letzten Jahrzehnten hat sich eine neue produktive Kraft entwickelt. Diese neue produktive Fähigkeit drückt sich in erster Linie in neuen Arbeitsorganisationsformen aus, bei denen unternehmerische Funktionen zunehmend von Beschäftigten in Teamarbeit übernommen werden. Sie findet ihren Ausdruck aber auch in nicht teamförmig organisierter Arbeit. Innerhalb der kapitalistischen Verhältnisse belasten die Unternehmensleitungen die Verhältnisse der Beschäftigten untereinander mit dem Zweck des Profits. Mittels der Indirekten Steuerung üben sie Druck auf Beschäftigte aus. Die indirekte Steuerung äußert sich für die Beschäftigten in erster Linie in Burnout, Arbeitszeitentgrenzung, Stress usw. Dass sich die Beschäftigten heute mit dem gesellschaftlichen Sinn und den Rahmenbedingungen ihrer Arbeit und der Produktion auseinandersetzen, wird daran sichtbar, dass sie zunehmend unternehmerische Aufgaben übernehmen. Die Entwicklung der neuen produktiven Fähigkeiten ist innerhalb der kapitalistischen Verhältnisse beschränkt. Um sie weiterzuentwickeln, müssen wir die kapitalistischen Verhältnisse, insbesondere das Privateigentum an Produktionsmitteln überwinden. Wir können die neuen produktiven Fähigkeiten aber auch nutzen, um unsere Arbeits-und Lebensverhältnisse souveräner und freier zu gestalten. Wir wollen unsere Produktivität über die Grenzen/Schranken des Profits als Maßstab von Produktivität im Kapitalismus hinaus entwickeln. Die Fähigkeit der Beschäftigten, ihre Arbeit selbstständig zu organisieren und sich mit ihrem gesellschaftlichen Sinn auseinanderzusetzen, können sie wegen des Privateigentums an Produktionsmitteln nicht auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens anwenden. Eine sozialistische und demokratische Organisation unserer Produktion ist daher der nächste notwendige Schritt in der Weiterentwicklung unserer Fähigkeiten. Dafür ist es notwendig, Reformen politisch durchzusetzen, die auf einen umwälzenden Umbruch hinarbeiten. Eine wichtige Reform in diesem Sinne ist die Ausweitung der betrieblichen Mitbestimmung auf alle unternehmerischen Entscheidungen. Des Weiteren muss das Betriebsverfassungsgesetz umfassend verändert werden; dabei muss der Fokus darauf liegen, den Beschäftigten mehr Möglichkeiten zu erkämpfen, in denen sie die Bearbeitung der eigenen Arbeit an den gesellschaftlichen Anforderungen ausrichten können. Gleichzeitig müssen die Unternehmen, in denen es bereits demokratische Entscheidungsfindungen gibt – in erster Linie sind das genossinnenschaftlich organisierte Unternehmen – gestärkt werden und die Bedingungen zur Gründung genossinnenschaftlicher Unternehmen ausgeweitet werden.
Der Staat hat die Aufgabe, durch die Schaffung von echter Vollbeschäftigung dafür Sorge zu tragen, dass jeder nach seinen/ihren Fähigkeiten an der Gesellschaft teilhaben kann. Dazu gehört unter anderem die Sicherung eines guten Auskommens. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist für uns keine Alternative. Vielmehr streiten wir für eine Jobgarantie, die allen eine auskömmliche Arbeit garantiert. Arbeit ist für uns nicht nur die Möglichkeit ein gutes Auskommen zu generieren, sondern gleichzeitig Garant für gesellschaftliche Teilhabe, die allen Menschen zusteht. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse haben sich mittlerweile zu einem weit verbreiteten Missstand entwickelt. Daran tragen sowohl die neoliberale Wende in der Arbeitsmarktpolitik, an der auch die deutsche Sozialdemokratie entscheidend beteiligt gewesen ist, als auch Entwicklungen Schuld, die wir gegenwärtig unter den Stichworten Globalisierung, Digitalisierung und Automatisierung diskutieren. Die verschiedenen Formen der Prekarisierung von Arbeit bedürfen dringend einer politischen Regulierung, wenn wir der zunehmenden Spaltung unserer Gesellschaft entschlossen entgegentreten wollen. Das unbefristete Normalarbeitsverhältnis, das nach Tarifvertrag bezahlt wird, darf nicht Ausnahme sein, sondern muss wieder zum Regelfall werden. Leiharbeit, Werkverträge sowie Mini-, Midi-Jobs und unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung erweisen sich oftmals als Sackgassen in Erwerbsbiographien und erhöhen das Risiko, in Armut zu leben. Diese Beschäftigungsformen wollen wir hinter uns lassen und in sozialversicherungspflichtige Normalarbeitsverhältnisse überführen. Ebenso wollen wir sachgrundlose Befristungen abschaffen, die Sachgründe einschränken und für die verbliebenen befristeten Beschäftigten eine Befristigungsentschädigung einführen. Durch vereinfachte Regelungen bei der Allgemeinverbindlichkeit wollen wir dafür sorgen, dass künftig wieder flächendeckend nach Tarifvertrag bezahlt wird. Als ein zentrales Instrument zur Gestaltung der Lohnpolitik hat sich darüber hinaus der Mindestlohn erwiesen. Ihn wollen wir stärken und zu einer echten Teilhabe ermöglichenden und ausnahmslosen Untergrenze für die Bezahlung von Lohnarbeit entwickeln. Das Mindestlohnniveau muss so erhöht werden, dass es nach 35 Beitragsjahren zu einem Rentenanspruch oberhalb der Grundsicherung führt. Zur Lohngerechtigkeit gehört außerdem, dass wir uns dafür einsetzen, Vergütungsunterschiede aufgrund des Geschlechtes abzuschaffen, benachteiligende Arbeitsbedingungen beschäftigter Frauen zu verbessern, sowie entstehende Nachteile aufgrund von individu ellen Merkmalen wie bspw. Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Religion abzuschaffen.Digitalisierung in der Arbeitswelt ist eine Chance: Die Digitalisierung bringt Herausforderungen mit sich, die umgehend gelöst werden müssen, wenn wir sicherstellen wollen, dass der technologische Fortschritt tatsächlich zu einer Verbesserung der Lebenssituation von Menschen beiträgt. Schon heute steigt durch neue Arbeitszeitmodelle und den impliziten Zwang zur ständigen Erreichbarkeit die Gefahr der Entgrenzung zwischen Arbeits-und Freizeit. Dem wollen wir unter anderem durch ein Recht auf Nichterreichbarkeit begegnen. Damit auch die Ruhe-und Nachtzeiten durch klare technische Einschränkungen stärker eingehalten werden. Der Datenschutz muss dabei eingehalten und die Überwachung von Arbeitnehmerinnen durch den Arbeitgeber bekämpft werden. Die Digitalisierung wollen wir aber nicht nur als Gefahr wahrnehmen, sondern in erster Linie als Chance. So bietet sie die Möglichkeiten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, indem zum Beispiel die Arbeitszeiten flexibler nach den Bedürfnissen der Arbeitnehmerinnen gestaltet werden können. Durch ein Recht auf Homeoffice soll Arbeitnehmerinnen die Chance gegeben werden, einen Teil ihrer Arbeit von Zuhause aus zu erledigen. Die Arbeitsmittel sind hier aber genauso von den Arbeitgeberinnen zu finanzieren. Insbesondere aufgrund der damit einhergehenden Gefahr einer zunehmenden Entgrenzung der Erwerbsarbeit muss auch bei Heimarbeit darauf geachtet werden, dass tägliche Arbeitszeiten nicht überschritten werden. Auch zu Hause geleistete Arbeitszeit muss schließlich gleichwertig anerkannt und entlohnt werden und darf nicht mit Karriereeinbußen einhergehen. Bei der Einführung des Recht auf Homeoffice sind gerade die Mitbestimmungsrechte von Betriebsräten für die konkrete Ausgestaltung von Arbeitszeitmodellen sicherzustellen und zu erweitern. Die in den letzten Jahren, auch im Zuge der Digitalisierung entstandenen Produktivitätssteigerungen, sollten bei den Arbeitnehmerinnen ankommen. Deswegen wollen wir mittelfristig die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 25 Stunden bei vollem Lohn-und Personalausgleich. Neue Arbeitsformen wie sie zum Beispiel in der Plattformökonomie entstehen, dürfen nicht dazu führen, dass Arbeitsschutzgesetze aufgeweicht werden. Personen, die als Solo-Selbstständige in diesen Branchen arbeiten, müssen wieder zurück in die Sozialversicherungspflicht geholt werden, damit sie eine gesetzliche Absicherung vor den Lebensrisiken erhalten. Auch diese Branchen sollen demokratisiert werden, dafür müssen sich Arbeitnehmer*innen organisieren können. Deshalb brauchen wir eine Ausweitung des Betriebsbegriffs im BetrVG.
Nicht nur die Arbeitswelt steht vor großen Transformationen. Auch die Ausbildung wird sich ändern müssen, wenn wir junge Menschen in Zeiten des digitalen Wandels gut auf ihr Erwerbsleben vorbereiten wollen. Eine gute Ausbildung und ein gutes Duales Studium ist und bleibt aus unserer Perspektive die zentrale Voraussetzung für gute Arbeit und ein Leben in Teilhabe. Gerade mit Blick auf die zunehmende Spezialisierung und Technisierung von ganzen Berufsbranchen setzen wir uns für eine Qualitätsoffensive in der Ausbildung ein. Wir wollen das Ausbildungssystem der Berufsbilder festigen und Schmalspurausbildungen zurückdrängen. Letztere fördern die Abhängigkeit von einzelnen Arbeitgeberinnen und bieten nur selten einen Rahmen, in dem sich Auszubildende umfänglich mit ihrer künftigen Berufstätigkeit auseinandersetzen können. Deshalb setzen wir uns für eine Mindestausbildungsdauer von drei Jahren ein, die aufgrund von Vorqualifizierungen und allein auf Wunsch ders Auszubildenden verkürzt werden kann. Auszubildende sollen außerdem alle Tätigkeiten eines Berufsbildes von gut ausgebildeten Ausbilderinnen vermittelt bekommen. Das duale Studium gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Für dual Studierende müssen die gleichen Regeln gelten wie für klassische Auszubildende. Wichtig ist darüber hinaus, dass alle Menschen, die eine Ausbildung antreten wollen, auch die Möglichkeit dazu bekommen. Deshalb wollen wir eine Ausbildungsplatzgarantie einführen, die gegenüber dem Staat geltend gemacht werden kann. Ein solidarisches Ausbildungssystem bereitet aber nicht nur auf eine künftige Tätigkeit vor, sondern muss zudem Ausbildungsbedingungen garantieren, die ein selbstständiges Leben ermöglichen. Hierfür sind kostenlose Mobilität und bezahlbare Wohnangebote für Azubis ebenso notwendig wie eine Ausbildungsvergütung für alle Ausbildungsarten von mindestens 80% des tariflichen Durchschnitts, die zum Leben reicht. Alle in Zusammenhang mit der Ausbildung entstehenden Kosten müssen von den Arbeitgeberinnen übernommen werden. Da sich inzwischen nicht mal mehr jeder fünfte Betrieb in Deutschland an der Ausbildung von Fachkräften beteiligt, ist es notwendig, dass auch diese Betriebe zukünftig zur Finanzierung der Ausbildungskosten herangezogen werden. Wir brauchen deshalb ein Umlagesystem, das alle Betriebe in einen gemeinsamen Fonds einzahlen lässt und die Ausbildungsbetriebe dadurch entlastet, wie es sie in manchen Branchen schon auf Ebene der Sozialpartnerinnen gibt. Überschüsse aus dem Fonds sollen für die Finanzierung der staatlich geschaffenen Ausbildungsplätze, die im Zuge der Ausbildungsgarantie notwendig sein werden, Verwendung finden. Wir setzen uns für die Einführung eines kostenfreien Meisterinnenprogramms ein. Wir fordern, dass Empfänger des Meisterinnen-Bafögs, wie beim studentischen Bafög, nicht mehr als 50 % der Fördersumme als Darlehen zurückzahlen müssen. Wir setzen uns für eine Öffnung der Studierendenwerke für Auszubildende ein. Sie sollen zu Bildungsförderungswerken ausgebaut werden, die Beratungsangebote, Wohnraumversorgung und soziale Infrastruktur für Menschen in jeglicher Ausbildung zur Verfügung stellen. Sie sind zur Erfüllung ihrer Aufgaben finanziell auskömmlich auszustatten. Ihre Verwaltungsräte sollen nach echter Repräsentation ihrer Mitglieder zusammengesetzt werden und um Vertreterinnen der Gewerkschaften und der Auszubildenden erweitert werden.
Solidarität ist für uns Jusos ein zentraler, handlungsleitender Wert. Eine Gesellschaft, in der das Recht des Stärkeren überwiegt und jeder für sich selbst Sorgen muss, lehnen wir ab. Stattdessen streben wir nach einer Gesellschaft, in der Menschen füreinander einstehen, in der die Starken mehr schultern und damit jenen unter die Arme greifen, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Ausdruck dieser Solidarität ist aus unserer Perspektive ein gerechter Sozialstaat. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er allen Menschen auf Augenhöhe begegnet, sie und ihre Situation nicht stigmatisiert und vor allem Rahmenbedingungen bietet, in denen ein Leben in Teilhabe und ohne existenzielle Ängste möglich ist. Dabei sind wir uns bewusst, dass die Verhältnisse, in denen wir leben, eine besondere Herausforderung für Sozialstaatlichkeit darstellen. Das kapitalistische Gesellschaftsund Wirtschaftssystem produziert krasse Ungleichheiten, grenzt aus und ist Ursache für die zunehmende gesellschaftliche Spaltung. Unsere Idee des Sozialstaats versteht sich deshalb nicht nur als Antwort auf diese Schieflagen, sondern als Instrument, um mit den Logiken und Funktionsweisen des Kapitalismus zu brechen. Der Sozialstaat muss eine echte Garantie für alle sein und in jeder Lebenssituation ein menschenwürdiges Leben in tatsächlicher Freiheit ermöglichen. Das heißt für uns, dass wir nicht nur die Risiken des Lebens absichern, sondern die selbstbestimmte Gestaltung des eigenen Lebens unterstützen wollen. Auch wenn Menschen etwas wagen und vielleicht dabei scheitern, muss der Sozialstaat als Auffangnetz wirken. Bei Jobverlust, im Krankheitsfall oder wenn sich die Lebenssituation aus welchem Grund auch immer ändert, ist für uns klar: Niemand kann weniger als das Existenzminimum haben, das ein Leben ohne Angst und in Würde garantiert und niemand darf aus dem sozialen Sicherungsnetz herausfallen. Sozialversicherungen zu solidarischer Bürgerinnenversicherung ausbauen: Wir wollen die Sozialversicherungen zur universellen Bürger*innenversicherung ausbauen, in der alle Erwerbsformen berücksichtigt werden. Dies soll insbesondere für die bestehenden Formen der Gesundheits-, Pflege-und Rentenversicherung gelten. Ferner wollen wir die bestehenden Beitragsbemessungsgrenzen abschaffen, um ein wirklich solidarisches System zu schaffen.
Arbeit ist für uns der Schlüssel zu individueller Freiheit und Teilhabe an der Gesellschaft. Wir brauchen deshalb einen Umbau der Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung, die möglichst viele Menschen absichert. Insbesondere neue Beschäftigungsformen, atypisch Beschäftigte oder sogenannte Solo-Selbstständige müssen in den Schutz der Arbeitsversicherung aufgenommen werden. Anspruch auf die Versicherungsleistung muss früher erworben werden, als es bislang der Fall ist. In Zeiten von unsteten Beschäftigungsverhältnissen und Befristungen muss es zur Regel werden, dass auch nach kurzer Anwartschaft Arbeitslosengeld I gezahlt wird, allen Arbeitnehmer*innen stehen nach Verlust ihrer Arbeit 12 Monate ALG I zu. Anders als in der Rentenversicherung wollen wir in der Arbeitsversicherung das Äquivalenzprinzip stärken, wer lange eingezahlt hat, dem steht auch länger etwas von der Arbeitsversicherung zu bis zu 36 Monate. Auch das Statuserhaltungsprinzip wollen wir wieder als Grundprinzip in der Arbeitsversicherung verankern. Dazu gehört eine entsprechende Bezugshöhe von 70% des Bruttobemessungsentgelts. Außerdem sind immer mehr Menschen auf Aufstockung angewiesen, dagegen brauchen wir ein Mindestarbeitslosengeld, das über der Grundsicherung liegt. Auch die Zumutbarkeitsregelungen bei der Weitervermittlung in einen neuen Job müssen sich ändern. Das Ziel muss dabei klar sein: Menschen in stabile Arbeitsverhältnisse mit vernünftigem Einkommen und einen Job in dem sie tatsächlich arbeiten möchten zu vermitteln.
Der Wandel der Arbeitswelt birgt viele Herausforderungen, gerade Erwerbsbiographien, in denen ein Beruf erlernt wird und von der Ausbildung bis zur Rente in einem Betrieb gearbeitet wird, gehören immer mehr der Vergangenheit an. Wir werden deshalb dafür Sorge tragen, dass Weiterbildung und Umschulung der gleiche Stellenwert zukommt wie der Schul-und Ausbildung. Dafür werden wir die Arbeitsversicherung brauchen. Aber auch die Betriebe entlassen wir dabei nicht aus ihrer Verantwortung: Weiterbildung im Betrieb muss aufgewertet und organisatorisch unterstützt werden. Ein Recht auf Weiterbildung muss dabei auch gesetzlich ausgebaut werden. Dazu müssen auch die Bildungsurlaubsgesetze der Länder harmonisiert werden. Daneben fordern wir den Bund und die Länder auf, kleine und mittlere Unternehmen bei der Lohnfortzahlung zu unterstützen, um den Arbeitnehmer*innen eine Weiterbildung zu ermöglichen. Wenn Arbeitsplätze durch den rasanten Wandel und technologischen Fortschritt wegzufallen drohen, brauchen wir einen Rechtsanspruch auf Umschulung auch bevor der Job tatsächlich weg ist. Außerdem wollen wir innerhalb der Arbeitsversicherung ein flexibel nutzbares Zeitkonto einrichten.
Arbeitslosigkeit ist kein individuelles Problem, sondern durch das kapitalistische System verursacht. Deshalb ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, einen Weg aus dieser Situation zu ermöglichen, diese Aufgabe übernimmt zum einen die Arbeitsversicherung. Zum anderen folgt für uns daraus: Wir brauchen eine Jobgarantie. Damit wird sichergestellt, dass möglichst niemand aus der Leistung der Arbeitsversicherung mehr in die Grundsicherung fällt, sondern durch den sozialen Arbeitsmarkt oder neue Subventionsmöglichkeiten eine neue Erwerbstätigkeit übernehmen kann. Grundsicherung betrifft dann insbesondere diejenigen, die nicht erwerbstätig sein können. Auch ihnen wollen wir ein Leben ohne existenzielle Ängste und mit individueller Handlungsfreiheit ermöglichen, dazu gehört die Sanktionsfreiheit und eine Grundsicherung, die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht, dafür muss die Höhe gegenüber heute deutlich ansteigen. Außerdem wollen wir die Grundsicherung in die Arbeitsversicherung integrieren. Die Finanzierung der Grundsicherung über Steuermittel bleibt dabei unangetastet.
Armut wird vererbt. Aktuell gilt jedes fünfte Kind in Deutschland als arm und auch die Zahl der von Armut bedrohten Kinder nimmt jährlich zu. Dass Zukunftschancen, Bildungschancen und Chancen im Erwerbsleben maßgeblich von den Eltern und deren finanzieller Situation abhängen, ist nicht neu, für uns aber nicht hinnehmbar. Wir fordern einen Paradigmenwechsel. Kinder gehören raus aus der elterlichen Grundsicherung und dürfen auch nicht Teil einer Bedarfsgemeinschaft sein. Eine Kindergrundsicherung muss eine existenzsichernde und mehr Chancengerechtigkeit bietende Lebensgrundlage sein. Dabei setzen wir uns für eine Streichung der einseitig Wohlhabende begünstigenden Kinderfreibeträge zu Gunsten der Kindergrundsicherung ein.
Die Fehlentwicklungen in der Rente durch einen neoliberalen Fokus auf die Senkung der Beitragssätze und das Abschieben der Verantwortlichkeit für Altersvorsorge in den privaten Bereich, müssen ein Ende haben. Das gute Leben muss auch im Alter garantiert sein, dafür braucht es eine Stabilisierung des Rentenniveaus bei 53%. das Rentenniveau muss deshalb wieder konsequent an die Lohnentwicklung gekoppelt werden. Wir wollen außerdem wieder mehr Solidarität in der Rente. Die Beitragsbemessungsgrenzen müssen dafür abgeschafft werden, während gleichzeitig die maximal erreichbaren Entgeltpunkte gedeckelt werden müssen. Damit führen wir eine Maximalrente ein. Auch auf steuerliche Zuschüsse können wir, um unserem eigenen Anspruch das gute Leben auch im Alter zu garantieren gerecht zu werden, nicht verzichten. Versicherungsfremde Leistungen wie eine Grundrente oder die Mütterrente müssen vollständig steuerfinanziert umgesetzt werden. Um ein Rentenniveau von 53% zu erreichen, können in den nächsten Jahrzehnten auch moderate Beitragssteigerungen notwendig werden. Bei steigenden Löhnen durch eine deutliche Anhebung des Mindestlohns und Produktivitätssteigerungen, ist dies für uns vertretbar. Außerdem wollen wir die Rentenversicherung zu einer Versicherung für alle ausbauen. Alle Erwerbstätigen (u.A. Selbstständige oder Beamt*innen) sollen Teil der Solidargemeinschaft sein, zur Erweiterung der Beitragsgrundlage genauso wie um Selbstständigen den Schutz der gesetzlichen Rentenversicherung zuteilwerden zu lassen. Auch wenn wir die Stabilisierung bei 53% erreichen, gibt es in der heutigen Situation, durch Unterbrechungen im Erwerbsleben, durch Befristungen oder prekäre Beschäftigungsverhältnisse die Notwendigkeit eine Mindestrente für alle steuerlich sicherzustellen. Eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung ist dafür der richtige Weg.
Der Sozialstaat muss nicht nur allen Menschen das gute Leben ermöglichen, sondern dabei auch explizit patriarchale Ungerechtigkeiten in den Blick nehmen. Ein neustrukturierter Sozialstaat, muss sich mit all seinen Sozialpolitiken von vornherein am Leitbild der Geschlechtergerechtigkeit ausrichten und nicht mehr nur rückwirkend Lücken füllen. Aktuell sind insbesondere Frauen von Altersarmut betroffen und das Risiko durch einen Wandel der Lebenssituation in Armut abzurutschen, ist für Frauen aufgrund des immer noch vom Sozialstaat geförderten Alleinernährer-Modells deutlich erhöht. Care-Arbeit an sich muss durch gezielte Umstrukturierung zum Beispiel von Elternzeitregelungen oder der Abschaffung des Ehegattensplittings geschlechtergerechter verteilt werden. Um diese Umverteilung der Care-Arbeit zu unterstützen, darf Care-Arbeit und damit verbundenen Erwerbsunterbrechungen nicht mehr zum Armutsrisiko werden. Ein geschlechtergerechter Sozialstaat muss diese Unterbrechungen auch in Bezug auf Rentenansprüche oder Ansprüche an eine Arbeitsversicherung berücksichtigen. Auch eine Änderung im Normalarbeitsverhältnis mittelfristig hin zu einer 25-Stunden-Woche muss Teil eines feministischen Sozialstaatskonzeptes sein.
Demokratisierung der Wirtschaft und Vergesellschaftung der Produktionsmittel: Die fehlende Demokratisierung der Wirtschaft stellt für uns das größte Demokratiedefizit der Gesellschaft dar. Wir Jusos setzen uns für eine Wirtschaftsordnung ein, in der nicht nur die einzelnen Betriebe, sondern auch die Entscheidung darüber was und wie insgesamt von einer Gesellschaft produziert wird, demokratisch und nicht einseitig von den Kapitaleigentümerinnen getroffen wird. Wir Jusos halten ein Privateigentum an Produktionsmitteln für unvereinbar mit einer demokratischen und sozialistischen Wirtschaftsordnung. Die Produktionsmittel müssen denen gehören, die mit ihnen arbeiten oder in deren Diensten sie stehen. Der Widerspruch von Kapital und Arbeit kann nur dann aufgehoben werden, wenn Produktionsmittel Gemeineigentum sind und Kapitalistinnen sich keinen Mehrwert der Lohnarbeitenden mehr aneignen. Wir wollen daher die Vergesellschaftung der wesentlichen Produktionsmittel und die Entwicklung einer demokratischen und sozialistischen Organisation der Wirtschaft, die sich daran ausrichtet, was gesellschaftlich sinnvoll ist und unsere Bedürfnisse befriedigt. Zu den wesentlichen Produktionsmitteln gehören insbesondere:
Grund und Boden
große Fabriken und ähnliche Produktionsstätten samt der dort eingesetzten Maschinen, Roboter und automatisierten Systeme;
sämtliche der Daseinsvorsorge dienende Strukturen und Systeme, insbesondere Elektrizitäts-, Internet-, Wasser-und Gasnetze;
große Logistikstandorte;
digitale Plattformen mit Standort in der Bundesrepublik, die zur Vermittlung von Waren und anderen Produkten sowie zur Verarbeitung von persönlichen Daten dienen;
Banken samt ihrer (digitalen) Zahlungsstrukturen;
Kapitalvermögen, die eine festgesetzte Grenze übersteigen
Auf dem Weg zu einer sozialistischen Organisation der Wirtschaft wollen wir die Ausweitung der betrieblichen Mitbestimmung auf alle unternehmerischen Entscheidungen schnellstmöglich erreichen. Das schließt insbesondere die demokratische Wahl von Führungspositionen in Unternehmen seitens der Beschäftigten ein. Dabei ist eine Frauenquote bindend.
Das aktuelle Wirtschaftssystem mehrt zwar langfristig den Wohlstand der Bevölkerung gemessen am Bruttoinlandsprodukt, versagt jedoch vor der Aufgabe, eine gerechte Primärverteilung von Gütern herzustellen. Wir setzen uns für ein Wirtschaftssystem ein, das eine möglichst gleiche und bedarfsgerechte Verteilung des Wohlstandes aus sich selbst heraus gewährleistet. Das existierende Wirtschaftssystem ist streng wachstumsorientiert. Ziel eines sozialistischen Wirtschaftssystems muss es ebenfalls sein, den gesamtgesellschaftlichen Wohlstand zu mehren und jeder Generation das Versprechen auf ein besseres Leben als das der Vorherigen erfüllen. Dementsprechend ist ein sozialistisches Wirtschaftssystem unvereinbar mit postmaterialistischen Degrowth-Ansätzen. Das Wachstumsversprechen allein gewährleistet jedoch keine besseren Lebensverhältnisse. Nur wenn Wachstum unter dem Vorbehalt der ökologischen Nachhaltigkeit, einer gleicheren Verteilung des Wohlstandes und eines global gerechten Wachstums gestellt wird, also nicht auf der einseitigen Ausbeutung geringer entwickelter Volkswirtschaften beruht, genügt es sozialistischen Ansprüchen.
Ein zentrales Problem des Kapitalismus ist die massive Ungleichheit in der Verteilung von Kapital, welche sich -systembedingt -immer weiter zuspitzt. Sie zu überwinden ist eine zentrale Aufgabe sozialistischer Politik. Dafür müssen wir Kapital von den Reichen nehmen und dem Gemeinwesen zuführen. Ein Mittel zur Erreichung dieses Ziel ist ein gerechtes Steuer-und Abgabensystem. Die progressive Einkommensteuer muss beibehalten werden. Sie -und nicht Verbrauchsteuern -gewährleistet, dass mehr beiträgt, wer auch mehr hat. Aber Einkommen -insbesondere aus abhängiger Beschäftigung -sind im Moment viel stärker an der Finanzierung unseres Gemeinwesens beteiligt, als Kapital. Ziel muss sein, das zu ändern. Die großen Vermögen müssen ebenfalls ihren Anteil in angemessener Höhe zum Gemeinwesen beitragen. Gleichzeitig muss der Ungleichverteilung eine Grenze gesetzt werden. Denn immer noch sind Vererbungen und Schenkungen und damit die Weitergabe von großen Vermögen zwischen einigen Wenigen, die Hauptursache der zunehmenden Ungleichverteilung von Wohlstand in unserer Gesellschaft. Wir wollen eine effektive Vermögens-und eine hohe Erbschaftsteuer.
Wettbewerb um die besten Lösungen ist die Quelle gesellschaftlicher Innovation. Ein demokratisiertes Wirtschaftssystem unterscheidet sich von einer kapitalistischen Wirtschaft allerdings dadurch, welche Kriterien es für den unternehmerischen Wettbewerb setzt und in welchen Rahmen es diesen einbettet. Während in kapitalistischen Wirtschaftssystemen der Wettbewerb einseitig dem Kriterium der Profitabilität folgt und damit stets monopolisierende Tendenzen hat, die dem Ziel einer möglichst innovativen Wirtschaft wiederum entgegenstehen, muss ein sozialistisches Wirtschaftssystem einen Wettbewerb um die besten Ideen, statt um die höchsten Profite gewährleisten. Die gesellschaftliche Kapitalbereitstellung für Unternehmen muss dementsprechend gesamtgesellschaftlichen Kriterien folgen, statt einer reinen Profitorientierung zu dienen. Monopole stehen dem Ziel einer innovationsorientierten Wirtschaft grundsätzlich entgegen. Das Ziel von Wirtschaftspolitik im Rahmen kapitalistischer Ökonomie ist es daher stets, Monopole zu vermeiden. Bestimmte Märkte haben jedoch aufgrund hoher Fixkosten eine natürliche Monopoltendenz. Dies ist insbesondere in Teilen der Wirtschaft der Fall, die die Daseinsvorsorge, insbesondere Infrastruktur und Versorgungsnetze betreffen. Diese Märkte sind sinnvollerweise zu verstaatlichen oder in anderer Form zu Vergesellschaften, dann jedoch unter besonders starke staatliche Aufsicht zu stellen, um ausbeuterische Tendenzen zu vermeiden, die hier auch unabhängig von der Eigentümer*innenschaft an den Produktionsmitteln auftreten können.
Die ursprüngliche Funktion von Banken, als Schnittstelle zwischen denen, die Geldmittel haben und jenen, die für ihre Unternehmungen Kapital brauchen, ist Voraussetzung für jedes moderne Wirtschaftssystem. Seit der Existenz des Bankensektors hat er sich jedoch zunehmend von dieser Vermittlerfunktion fortentwickelt, hin zu einem Instrument, das die Profitinteressen der Kapitalgeberinnen und der Eigentümerinnen maximiert, indem maximal hohe Profite aus Investitionen gezogen werden sollen. Damit schafft der privatwirtschaftliche Sektor zwar nicht die Voraussetzungen für die krisenhaften Tendenzen des kapitalistischen Wirtschaftssystems, allerdings verstärkt er die auftretenden Krisen in ihrer Intensität. Auf der Suche nach Profiten der sich stetig vergrößernden Kapitalmenge bei gleichzeitig sinkender Profitrate wird die Entstehung von Blasen durch Überproduktion in bestimmten Marktsegmenten durch entsprechende Investitionen unterstützt. Platzen diese Blasen geht dies mit sozial einschneidenden, gesellschaftlichen Konsequenzen einher, wie zuletzt bei der Finanzkrise 2007/2008 deutlich gesehen. Ziel eines sozialistischen Finanzsystems ist es, den Finanzsektor in die Funktion der Aufbewahrung von Geldmitteln und die Zurverfügungstellung von Kapital für Unternehmungen zu überführen. Die Entscheidung, welche Zwecke im Grundsatz kreditwürdig sind, soll unter demokratische Kontrolle gestellt werden. Es geht nicht darum über jeden einzelnen Hauskredit abzustimmen, sondern um Grundsatzfragen auf der Makro-Ebene.
Die Vergabe von Krediten für Unternehmen darf dabei nicht der Profitmaxime folgen, sondern aus den demokratischen Erwägungen, welche Art von Investitionen und Unternehmungen gesellschaftlich wünschenswerten sind. Diese Ziele müssen demokratisch von den jeweiligen Trägerinnen der Banken vorgegeben werden. Damit kann der Bankensektor eine wesentliche Rolle bei der Kontrolle der gesamtgesellschaftlichen Produktion spielen. Kredite an Unternehmen werden demokratisch bestimmt und daran ausgerichtet, ob die Produkte der Unternehmen gesellschaftlichen Anforderungen genügen. Die Verzinsung ist im Kapitalismus Ausprägung der Mehrwertaneignung. Er setzt sich zusammen aus der Risikoprämie und den “Kapitalkosten”. Letztere sind Ausdruck der Aneignung fremder Arbeit durch die Kapitalistinnen. Ein sozialistisches Bank-und Finanzsystem muss zwar der sicheren und werterhaltenden Aufbewahrung von Geldmitteln auch von Privatpersonen dienen, es darf jedoch niemals Kapitalerträge erwirtschaften. Der Zins bei der Kreditvergabe durch Banken muss sich insofern in seiner Funktion auf die Absicherung von unternehmerischen Risiken und Verwaltungskosten, die bei den Banken anfallen, beschränken, darf jedoch nicht darüber hinaus gehen. Sobald der Bankensektor einer Gewinnorientierung folgt, beseitigt er die Voraussetzungen einer sozialistischen Wirtschaft.
Von den drei Säulen der Sparkassen, Genossenschafts-und privaten Banken folgen nur letztere ausschließlich der kapitalistischen Profitmaxime. Hier setzen wir uns langfristig für eine Verstaatlichung des privaten Banksektors und Überführung in ein System nationaler und europäischer Förderbanken ein, die Unternehmungen, für die große Kapitalmittel benötigt werden, fördern. Sparkassen in kommunaler Trägerschaft sind bereits jetzt ein grundsätzlich sozialistisches Strukturelement im deutschen Bankensektor. Das Sparkassengesetz muss dahingehend verschärft werden, dass der öffentliche Auftrag der Sparkassen zur lokalen Wirtschaftsförderung verstärkt wird. Vergütungsmodelle für Vorstände, die Anreize schaffen, dass Sparkassen zunehmend faktisch gewinnorientiert arbeiten, müssen ausgeschlossen werden. Kommunale Satzungen sollen den öffentlichen Auftrag den örtlichen Verhältnissen entsprechend definieren und dadurch die öffentliche Zweckorientierung sichern. Genossenschaftsbanken sind Ausdruck der demokratischen Selbstorganisation von privaten und unternehmerischen Kundinnen. Ihre Stellung muss gestärkt werden. Voraussetzung für die Anlage von Geldmitteln und die Kreditaufnahme muss die Mitgliedschaft sein. Somit wird sichergestellt, dass die Genossinnen alle die Möglichkeit der Entscheidung über die Bedingungen und Kriterien haben anhand derer die gegenseitige Zurverfügungstellung von Krediten gewährleistet wird. Insbesondere eignen sich Genoss*innenschaftsbanklösungen für die finanzielle Selbstorganisation von Wirtschaftsbranchen, die durch mittelgroßen Unternehmen geprägt sind. Großunternehmen benötigen Kapital, das von einem kleinteiligen Banksystem nicht zur Verfügung gestellt werden kann. An die Stelle von Großbanken muss ein System staatlicher auf nationaler und europäischer Ebene angesiedelten Förderbanken treten, die die entsprechende Aufgabe der Finanzierung übernehmen. Die Vergabe von Krediten muss dabei strikt gesetzlich vorgegebener Kriterien folgen, sodass eine demokratische Legitimation sichergestellt ist.
Durch den gemeinsamen Währungsraum und dem damit gemeinsamen Wechselkurs entstehen zwischen den Ländern enorme Ungleichgewichte von denen Nettoexporteure, also insbesondere Deutschland, extrem profitieren, während Nettoimporteure stark darunter leiden. Um diese negativen Umverteilungseffekte zu bekämpfen, wollen wir einen europäischen Finanzausgleich zwischen den Euroländern und setzen uns für den Abbau der Handelsungleichgewichte hin zu ausgeglichen Leistungsbilanzen ein. Die EZB ist formell allein dem Inflationsziel verpflichtet. Faktisch handelte sie insbesondere in der Eurokrise an diesem Mandat vorbei um den Euroraum zu retten. Wir fordern, dass das Mandat der EZB erweitert wird und fortan auch die übergeordneten Ziele der wirtschaftlichen Konvergenz und das Wachstum von Wirtschaft und Beschäftigung umfasst. Direkte Eingriffe in die Wirtschaftspolitik der Mitgliedsstaaten, wie im Rahmen der Troika geschehen, müssen hingegen ausgeschlossen sein. Die Macht der EZB steht in keinem Verhältnis zu ihrer demokratischen Legitimation. Wir fordern, dass das Direktorium der EZB als zentrales Entscheidungsorgan der europäischen Geldpolitik vergrößert wird und als solches alle fünf Jahre vom Europäischen Parlament neu gewählt wird. Die Rolle der nationalen Notenbankpräsident*innen soll auf die reine Beratung reduziert werden. Wir fordern, dass der ESM hin zu einem europäischen Währungsfonds umgebaut wird, der in Schwierigkeit geratene Euroländer durch gezielte Investitionen unterstützt. Es muss Schluss sein mit der Austeritätspolitik, die Länder in wirtschaftlicher Not noch weiter destabilisiert.
Das aktuelle Weltwährungssystem setzt insbesondere sich entwickelnde Schwellenländer extremen Währungsrisiken aus, die einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung entgegenstehen. Insbesondere die Währungen kleinerer Länder sind dabei dem negativen Einfluss von Währungsspekulationen ausgeliefert. Als Reaktion koppeln diese Länder häufig ihren Währungskurs an große Währungen, wie den Dollar, dem dadurch faktisch die Funktion einer Leitwährung zukommt, und kleinere Länder zwingt, Devisen anzukaufen, um die Stabilität der eigenen Währung zu gewährleisten. Wir streben ein Weltwährungssystem an, das unabhängig ist von spekulativen Schocks und das einer transparenten politischen, statt einer marktbasierten Steuerung unterliegt. Dafür kommen sowohl die Gründung bzw. der Ausbau regionaler Währungsgemeinschaften auf anderen Kontinenten nach dem Vorbild des Euros als auch die Weiterentwicklung der Sonderziehungsrechte im Rahmen eines multipolaren Weltwährungssystems zu einer Art synthetischer Leitwährung, die die Wechselkurse der beteiligten Währungen zueinander festlegt, infrage. Bei der Einrichtung und politischen Steuerung des Systems gilt es, darauf zu achten, weder kleine Staaten oder Schwellenländer zu übervorteilen oder in das System hineinzuzwängen, noch Handelsbilanzüberschüsse oder -defizite durch Wechselkurse festzuschreiben. Den Zentralbanken kommt dabei die Aufgabe zu, die Wechselkurse in engen Grenzen zu garantieren und damit für Stabilität zu sorgen.
Daseinsvorsorge in öffentliche Hand: Wir haben einen umfassenden Begriff der Daseinsvorsorge, der von digitaler Infrastruktur bis hin zu Sport und Kultur die wesentlichen Bereiche des Lebens umfasst. Die Gewährleistung von Daseinsvorsorge gehört für uns zu den sensibelsten und wichtigsten Aufgaben einer Gesellschaft, bei der der Versuch der Organisation über einen privatwirtschaftlichen, wettbewerbsorientierten Markt besonders fatale, sozial negative Folgen haben kann. Alle Bereiche der Daseinsvorsorge gehören deshalb in die öffentliche Hand oder müssen den jeweiligen, besonderen Bedürfnissen entsprechend in der Form vergesellschaftet werden, dass eine rein wirtschaftliche Gewinnorientierung ausgeschlossen ist. Zudem müssen den Bedürfnissen entsprechend partizipative Ansätze entwickelt werden, damit der jeweilige Bereich der Daseinsvorsorge die wirklichen Bedürfnisse der Nutzer*innen befriedigen kann. Nur so kann die Teilhabe für alle gesellschaftlichen Gruppen gewährleistet werden und unser Leitbild einer demokratischen und solidarischen Gesellschaft verwirklicht werden.
Die umverteilenden und absichernden Aufgaben des Sozialstaats müssen die Grundlage dafür sein, dass in unserer Gesellschaft niemand existentielle Ängste hat. Ein Recht auf Stadt und an der Stadt bezieht sich nicht auf urbane Räume, sondern auf eine funktionierende Infrastruktur für die Bedürfnisse des täglichen Lebens, die staatlich organisiert sein muss. Dazu gehören für uns Mobilität, Gesundheitsversorgung, Wohnraum, Umwelt, soziale Infrastruktur wie zum Beispiel Kinderbetreuung, pflegerische Versorgung, Versorgung mit allen Gütern, die wir im Alltag benötigen und die Erreichbarkeit von Dienstleistungen. Diese Aufgaben wurden in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend an private Akteurinnen abgegeben. Gleichzeitig findet eine verhängnisvolle Verdrängung ökonomisch schwächerer Gruppen aus den Zentren statt, die bis heute anhält. Genauso wenig wie das Leben in der Stadt Privileg der Wohlhabenden sein darf, darf in ländlichen Räumen das Gefühl des Abgehängtseins entstehen. Eine wohlhabende Gesellschaft darf nicht zulassen, dass periphere Räume entstehen, in denen es am Nötigsten in allen Lebensbereichen mangelt. Für uns geht Daseinsvorsorge aber noch viel weiter: jeder muss unabhängig vom Wohnort teilhaben können an der Stadt und dem gesellschaftlichen Leben in ihr. Dazu gehören kulturelle und sportliche Angebote, Räume für Kinder und Jugendliche oder individuell nutzbare Freiräume für alle, aber auch Gestaltungs-oder Mitwirkungsmöglichkeiten an der Stadt gehören dazu. Für das gute Leben für alle braucht es Investitionen in all das – denn Zukunft gibt es nicht für lau.
Gleichwertige Lebensverhältnisse sind für uns eine Frage der Gerechtigkeit. Ein gutes Leben mit allem, was notwendig ist, und mit einem Angebot zur Teilhabe darf es nicht nur für Menschen geben, die in urbanen Räumen leben oder wohlhabend sind. Auch in immer kleiner werdenden Dörfern und Gemeinden muss die Versorgung funktionieren. Jede*r muss in der näheren Umgebung eine Möglichkeit finden, Geld abzuheben, Post zu verschicken oder am gesellschaftlichen Leben, sei es in den Vereinen oder in der Gastwirtschaft, teilzuhaben. Aber auch Bedarfe, die deutlich schwieriger abzudecken sind, gehören für uns dazu: Eine ärztliche Versorgung zu erhalten, im Zweifel durch Telemedizin, Polikliniken oder durch fahrende Praxen. Von Kommunen organisierte Verkaufsstände an einzelnen Wochentagen oder Kooperationen von verschiedenen Einzelhandelsmärktensind für uns dabei mögliche Lösungen.
Niemand darf dazu gezwungen sein auf der Straße leben zu müssen, weil kein Wohnraum zur Verfügung steht. Hier sehen wir den Staat in der Pflicht. Die freie Wahl des Wohnortes steht dabei unverhandelbar jedem*r zu, genauso wie die Möglichkeit bezahlbaren Wohnraum zu beziehen. Staatliche Gestaltungsspielräume, das sicher zu stellen, haben durch den neoliberalen Ausverkauf in den letzten Jahrzehnten immer weiter abgenommen. Die Resultate sind in viele Städten dramatisch. Leerstand, während in der ganzen Stadt Wohnungsnot herrscht, Luxussanierungen in der einen und Renovierungsbedarf in der anderen Wohnung, Gentrifizierung im einen, fehlende Investitionen im anderen Stadtteil, der Anteil an preisgebundenen Wohnungen reduziert sich, während Bedarfe zunehmen. Die private Zurverfügungstellung von Wohnraum darf als weitgehend gescheitert angesehen werden. Der Versuch der staatlichen Regulierung des privaten Sektors, z.B. mittels Mietpreisbremsen usw., alleine wird die Missstände nicht beheben. Es braucht eine 180-Grad Wende in der Wohnungspolitik! Die privatwirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Wohnraum darf nur noch die Ausnahme sein. Unsere sozialistische Wohnraumpolitik begegnet diesen Fehlentwicklungen mit verschiedenen Instrumenten. Sozialer Wohnungsbau durch kommunale Wohnungsbaugesellschaften, mit festen, zeitlich nicht befristeten Quoten für sozial gebundenen Wohnungsbau in allen Neubauten ist dabei ein wesentliches Element. Mietpreisdeckel, mit einer zeitlichen Befristung eines Mietwohnraum-Leerstandes auf maximal drei Monate, der verstärkte Ankauf von Mietpreis-und Belegungsbindungen, verschärfte soziale Erhaltungssatzungen zum Schutz angestammter Milieus, eine Entfristung der Gewinnbesteuerung beim Weiterverkauf von Wohnraum oder die Deckelung der Zahl an Immobilien, die ein Mensch besitzen darf, können nur Elemente sein, die kurz-und mittelfristig Entlastung bringen. Langfristig muss es das Ziel sein, den Wohnungsmarkt zu vergesellschaften. Neben dem öffentlichen Wohnungsbau spielt dabei die Stärkung von Wohnbaugenossenschaften, aber auch die Schaffung der Voraussetzungen für die Enteignung von Großunternehmen auf dem Wohnungsmarkt gegen die Entschädigung zum Erwerbspreis der Immobilien eine wichtige Rolle. Das Recht auf Wohnen ist für uns nicht verhandelbar und erfordert beherztes staatliches Eingreifen.
Ziel demokratisch, sozialistischer Bodenpolitik sollte es sein, das Gemeininteresse in Abgrenzung zum Einzelinteresse durchzusetzen. Für uns ist deshalb langfristig klar: niemand soll Eigentum an Grund und Boden haben, dieser gehört in öffentliche Hand. Die Vergabe im Rahmen von Erbbaurechten durch die Kommune, das Land oder den Bund bietet immer noch ausreichend individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Auch kurzfristig brauchen wir einen Stopp der massiven Bereicherung durch Eigentum an Grund und Boden und die Spekulationen damit: eine Bodenwertzuwachssteuer, eine echte Besteuerung des Bodenwertes, keine Umlage solcher Steuern auf Mieter*innen. Wir wollen eine kommunale Bodenvorratspolitik, durch eine deutliche Ausweitung kommunaler Vorkaufsrechte. Damit können wir endlich wieder einen größeren Einfluss von Kommunen auf Boden-und Wohnungspreise gewinnen, aber auch unserem langfristigen Ziel kommen wir damit deutlich näher. Bauleitplanungsprozesse müssen vor allem am Gemeinwohl orientierte Ziele beinhalten und dem Grundsatz der Innenentwicklung folgen. Innenentwicklung ist für uns sowohl aus ökologischer als auch aus sozialer Sicht zentral: Statt immer mehr Menschen insbesondere mit geringem Einkommen aus den Innenstadt-Quartieren zu vertreiben und gleichzeitig immer mehr Wald, Wiesen, Agrarfläche zu reduzieren, müssen Brachflächen entwickelt, Geschossaufstockung umgesetzt, nachverdichtet oder Leerstand zeitlich befristet werden.
Mobilität ist zentrale Voraussetzung, um gute Arbeit aufnehmen zu können, für individuelle Freiheit und für gesellschaftliche Teilhabe. Ein sozial gerechtes Mobilitätskonzept in der Kommune oder im Kreis kann nur tatsächlich für alle zugänglich sein, wenn keine finanzielle Ausgrenzung stattfindet. Um diese Ziele zu erreichen, müssen regelmäßige Taktungen des ÖPNVs auch in ländlichen Gegenden gewährleistet sein. Außerdem müssen sie an den Bahnverkehr angepasst sein, um gute Anschlüsse an größere Städte anzubieten und so den ÖPNV attraktiver zu gestalten. Unsere Vision ist es, Verkehrskonzepte zu verwirklichen, die die ökologisch, sozial inklusiv und barrierefrei den motorisierten Individualverkehr obsolet machen und Ideen von autofreien Städten damit verwirklicht werden können. Dazu gehört auch der massive Ausbau und die Förderung des Fahrradnetzes, so dass diese die Straßen wieder zurückerobern können. Im Fernverkehr fordern wir eine bezahlbare Preisstruktur, Mobilität auch über die eigene Stadt -und Landkreisgrenze hinweg darf nicht nur Wohlhabenden möglich sein. Unser Ziel ist ein fahrscheinloser öffentlicher Nah-und Fernverkehr für alle.
Krank zu werden ist ein Risiko, vor dem niemand geschützt ist. Eine vollumfängliche Absicherung für dieses Risiko ist deshalb Ziel unseres sozialistischen Gesundheitssystems. Dazu gehört neben Prävention auch eine individuelle Behandlung und Pflege, die sowohl auf Diagnose als auch auf die gesamte Situation des erkrankten Menschen Bezug nimmt. Auch Rehabilitation und die Begleitung zurück in den Alltag und ggf. an den Arbeitsplatz gehören für uns zur umfassenden Absicherung im Krankheitsfall dazu. Diese Versorgung muss weiterhin auch wohnortnah möglich sein, der Erhalt von Kliniken insbesondere in ländlichen Räumen ist dafür unabdingbar. Kliniken gehören für uns in öffentliche Hand. Sie dürfen nicht durch private Unternehmen gewinnorientiert betrieben werden, sondern gehören in öffentliches Eigentum und müssen entsprechend der Bedürfnisse ausfinanziert werden. Wir setzen uns dafür ein, dass die Leitung von Kliniken in die Hände der Beschäftigten gelegt wird. Das medizinische Personal muss im Zuge der Demokratisierung von Kliniken strategische und wirtschaftliche Entscheidungen treffen können, um eine bestmögliche Versorgung fernab von ökonomischer Motivation sicherzustellen. Eine Leitung nur durch Betriebswirtinnen und Haushälterinnen lehnen wir ab. Die Gesundheitsversorgung, die wir uns vorstellen, nimmt den Menschen als Ganzes mit all seinen Bedürfnissen in den Blick, ein System in dem Hauptdiagnose und deren Hauptbehandlungsmaßnahmen zu einer Fallpauschalierung führt, lehnen wir ab. Nicht nur, dass ein solches Abrechnungssystem, wie es heute existiert, einen extrem hohen Dokumentationsaufwand erfordert, es werden Anreize zur möglichst frühzeitigen Entlassung gesetzt und gleichzeitig wird es dem tatsächlichen Bedarf desr Erkrankten nicht gerecht. Zu einer guten Gesundheitsversorgung gehören für uns alle erforderlichen pflegerischen Maßnahmen oder Behandlungen. Dazu gehören auch eine individuelle Erhebung des pflegerischen Versorgungsbedarfs, aus dem sich dann auch Personalbemessung ergeben. Um diesen Paradigmenwechsel in der Gesundheitsversorgung zu realisieren, brauchen wir die Bürgerinnenversicherung. Also die Ausweitung der Versicherungspflicht im Rahmen der Bürger*innenversicherung für alle, unabhängig vom Einkommen. Dadurch wird das Solidaritätsprinzip wieder zur Grundlage zwischen allen Versicherten und der Leistungsanspruch gilt wieder für alle gleich: Nach Bedürftigkeit.
Auf Pflege angewiesen zu sein, bedeutet abhängig sein und damit eine Einschränkung der persönlichen Freiheit. Unsere Maxime in der Pflege ist es, pflegebedürftigen Menschen mittels individueller Lösungen so lange wie möglich ein Leben in seinemihren angestammten und familiären Umfeld zu ermöglichen. Dezentralisierte Pflege in “Seniorinnen-WGs” und die Betreuung durch mobile Pflegekräfte mit Zuständigkeit für bestimmte Stadtviertel sind Lösungen, die sich in anderen Ländern, wie zum Beispiel den Niederlanden nicht nur als angenehmer für die Pflegebedürftigen, sondern überdies als kostengünstiger erwiesen haben. Gute Pflege geht mit guter Entlohnung der Pflegenden einher. Damit Menschen trotz Pflegebedürftigkeit gut versorgt werden und sich gleichzeitig die aktuellen prekären Bedingungen -unter denen Pflegerinnen arbeiten müssen, ändern, muss einiges getan werden. Bessere Rahmenbedingungen müssen Pflege so möglich machen, dass Professionell Pflegende ihre Kompetenzen wieder vollumfänglich anwenden und umsetzen können, dazu braucht es den Ausbau der Vorbehaltstätigkeiten und die endgültige Aufhebung der Trennung in Grund-und Behandlungspflege. Die Pflegeversicherung wird in die Bürgerinnenversicherung integriert und dabei von einer Teil-zur Vollversicherung umgebaut. Pfleger*innen stellen sicher, dass Menschen im Krankheitsfall oder im Alter optimal versorgt werden, mögliche gesundheitliche Veränderungen frühzeitig erkannt und behandelt werden, dass Menschen therapeutische Maßnahmen erhalten und sie währenddessen gut betreut werden. Dafür ist großes fachliches Wissen erforderlich. Es braucht aber auch gesellschaftliche Anerkennung. Diese Anerkennung muss unter Anderem auch durch gute Bezahlung, also in einem entsprechenden Pflegemindestlohn bzw. einen bundesweiten Pflegetarif zum Ausdruck kommen.
Kulturelle Angebote wahrnehmen zu können, muss allen Menschen möglich sein. Dazu gehört der Erhalt kleiner Einrichtungen, die wohnortnah Zugang zu kulturellen Angeboten ermöglichen genauso wie eine grundsätzlich stark kommunal subventionierte kulturelle Infrastruktur, die niemanden durch hohe Eintrittsgelder oder Beiträge ausschließt. Genauso müssen sportliche Aktivitäten für alle zugänglich sein. Infrastruktur wie Sportplätze, Schwimmbäder oder Sporthallen müssen staatlich betrieben und erhalten werden -in allen Quartieren einer Stadt genauso wie in ländlichen Regionen. Ebenso gehören Räume der Begegnung dazu, die von allen im Quartier genutzt werden können. Sei es ein öffentlicher Platz, Park oder ein Bürger*innenraum/haus mit unterschiedlich nutzbaren Räumlichkeiten. Diese Infrastruktur muss kostenlos nutzbar sein! Zugänglichkeit beschränkt sich aber nicht allein auf die Frage der kostengünstigen oder kostenlosen Zutrittsmöglichkeit zu kulturellen und sportlichen Einrichtungen. Kultur, Kunst, Sport und andere soziale Angebote müssen als Produkt unserer Gesellschaft verstanden werden, von deren Nutzung niemand ausgeschlossen sein darf. Dementsprechend setzen wir uns dafür ein, dass mit privatem Eigentum an Kunst-und Kulturschätzen die Pflicht der Ermöglichung des gesellschaftlichen Zugangs einhergeht. Kunstschätze, die ihr Dasein als Kapitalanlage in Depots oder Zollfreilagern fristen, pervertieren den eigentlichen Wert von Kunst, der sich durch seine gesellschaftliche Bedeutung ergibt. Das Gleiche gilt für Sportereignisse von gesellschaftlicher Bedeutung. Diese müssen kostenfrei für alle empfangbar sein. Natur erleben oder Naherholung sind für uns keine Themen, die nur der gehobenen Mittelschicht zugänglich sein sollten. Nicht nur zur Wiederherstellung der Arbeitskraft, sondern für die individuelle Entspannung, die gesundheitliche Erholung, als Pause vom Alltag oder als Raum für persönliche Freizeitgestaltung: der Zugang zu Parks, Wäldern, Wiesen, Seen und Flüssen gehört für uns auch zur Daseinsvorsorge. Diese Räume und den Zugang aller Menschen dazu zu gewähren ist eine staatliche Aufgabe, dazu müssen ausreichend finanzielle und organisatorische Ressourcen bereitgestellt werden.
Die Demokratie lebt von dem Grundsatz der Subsidiarität. Entscheidungen, die die Menschen unmittelbar betreffen, müssen unter ihrem direkten Einfluss stehen. Deswegen kommt den Kommunen eine so entscheidende Bedeutung zu. Das kommunale Selbstverwaltungsrecht wird untergraben, wenn externe Bedingungen, auf welche die Kommunen selbst keinen Einfluss haben, finanzielle Handlungsspielräume nehmen. Wirtschaftlichen Strukturentwicklungen muss auf höheren Ebenen entgegengewirkt und das Steuerdumping anderer Kommunen beendet werden. Darunter leidet die
Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass in allen Ländern funktionierende kommunale Finanzausgleichsmechanismen zwischen den Kommunen geschaffen werden. Dabei muss auf besondere kommunale Herausforderungen Rücksicht genommen werden und der teilweise ruinöse Wettbewerb um minimale Gewerbesteuern beendet werden. Außerdem muss das Besteller*innenprinzip fortan und rückwirkend implementiert werden. In den letzten Jahren wurden häufig Entscheidungen auf Bundes-und Landesebene getroffen, deren finanzielle Last die Kommunen tragen. Zudem betreffen viele in der Sache absolut richtige sozialpolitische Entscheidungen die Kommunen am stärksten, die jetzt schon unter der schlechtesten Einnahmesituation leiden. Für diese Aufgaben bedarf es finanzieller Transfers von Bundes-und Landesebene um gleichwertige Lebensverhältnisse für Alle zu gewährleisten.
Als Grundlage unseres Lebens wird Wasser von allen Menschen benötigt. Deshalb muss die Versorgung mit (Trink-)Wasser öffentlich sichergestellt und demokratisch organisiert werden. Das Menschenrecht auf Wasser schließt für uns privates Eigentum an Grundwasserquellen oder -brunnen und an Trinkwassergewinnungsanlagen aus. Auch die Versorgungsinfrastruktur muss zumindest für trinkbares Leitungswasser staatlich organisiert sein. Der gleiche Grundsatz muss auch für die Energieversorgung gelten. Eine private Zurverfügungstellung schließen wir aus, die Energie gehört in öffentliche Hand. Die Art und Weise wie wir als Gesellschaft Energie gewinnen/erzeugen wollen, ist für uns keine Privatsache. Die gesellschaftliche Verfügungsgewalt über Energiegewinnungstechniken und die damit verbundenen Anlagen, sowie das gesellschaftliche Primat über die Forschung an Zukunftstechnologien zur Energiegewinnung sind deshalb fester Bestandteil unserer Daseinsvorsorge-Konzepte.
Seit jeher ist das Verhältnis der demokratisch-sozialistischen Bewegung, derer sich die Jungsozialist*innen in der SPD als zugehörig verstehen, geprägt von einem Dualismus zwischen Staatsbefürwortung zum Zwecke der Durchsetzung sozialer und emanzipierender Normen und Staatsskepsis, die sich aus dem Bewusstsein über das unterdrückende Potentials einer außer Kontrolle geratenen Staatlichkeit ergibt. Zusammengefasst ist der Staat jungsozialistischer Vorstellung ein Staat, der innerhalb des Dualismus zur Zivilgesellschaft maximal emanzipierend und minimal repressiv agiert. In diesem Zusammenhang begreifen wir Staatlichkeit in ihrer Wirkungsweise als eine gefährliche Notwendigkeit.
Zunächst ist der Staat ein Konstrukt entstanden aus der Notwendigkeit menschliches Zusammenleben zu organisieren. In diesem Sinne ist jede Staatlichkeit zunächst Normgeber gesellschaftlicher und sozialer Verhaltensregeln. Das entscheidende Alleinstellungsmerkmal des Staates gegenüber allen weiteren gesellschaftlichen Norminstanzen liegt in der besonderen Natur staatlicher Normen selbst. Alle staatlichen Normen sind gesellschaftliche Normen, die für jedes Mitglied des Staates gelten. In diesem Zusammenhang verstehen wir jede normgebende Instanz, die in der Lage ist, solche verbindlichen Regeln aufzustellen, als Staat. Folglich ist ein staatenloser Raum nicht möglich, da es keinen herrschaftslosen Raum gibt.
Während die Verletzung allgemeiner sozialer Normen, wie Traditionen, Riten oder Gepflogenheiten zu einer Sanktionierung auf sozialer Ebene oder zum Teil zu gar keiner Sanktionierung führt, garantiert der Staat als normgebende Instanz für die Verbindlichkeit, indem er ihre Befolgung zwangsweise durchsetzt. Als Mittel dieser Durchsetzung bedient er sich des Gewaltmonopols als oberste Regel jeder Staatlichkeit. Nur der Staat ist nach dieser zum Einsatz unmittelbaren Zwangs und von Gewalt befugt. Dies gibt dem Staat im Gegensatz zu jeder anderen normgebenden Instanz gesellschaftlichen Zusammenlebens die Möglichkeit nicht nur Angebote zur Organisation des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu machen, sondern die Teilnahme an dieser zur generellen und allem übergeordneten Pflicht zu erklären.
Je nach Form des politischen Systems gibt es verschiedene Möglichkeiten der Einflussnahme der Gesellschaft. Hierbei sei festzuhalten, dass die potenziellen Einflussmöglichkeiten mit steigender Liberalität des Systems steigen und die Formen der Einflussnahme von der Zufriedenheit der Gesellschaft mit dem System abhängig sind. Differenziert werden muss natürlich immer zwischen den theoretisch vorhandenen Optionen und solchen, die einem Individuum tatsächlich aufgrund des persönlichen Status offen stehen.
Das Zustandekommen der staatlichen Regeln geschieht in klar definierten und öffentlich verwalteten Entscheidungsprozessen. Die Normen und Werte der Gesellschaft werden in Gesetzen fixiert. Dies geschieht mittels gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse. Da diese Kapazitäten binden und sehr aufwendig sein können, können sie nicht jeden Tag aufs Neue ausgetragen werden. Deshalb ist Staatlichkeit auch immer auf Langfristigkeit ausgelegt. Aus dem vorstehenden folgt die Erkenntnis, dass der Begriff des Staates nicht mit dem des Nationalstaates gleichzusetzen ist. Bei vollständiger Abwesenheit von Grenzen, bestünde immer noch die Notwendigkeit, das öffentliche Leben verbindlich zu organisieren. Ein Staat muss dabei gewisse Merkmale einer Staatlichkeit haben, damit er mit unserem Wertebild vereinbar ist.
Für uns Jusos ist der Staat immer ein demokratischer Staat. Er ist ein Mittel, um (gesellschaftliche) Veränderungen durch Politik herbeizuführen. Zwischen individuellen und kollektiven Interessen können Widersprüche bestehen. Dies ist einerseits nicht immer aufzulösen, andererseits kein Grund, auf das Prinzip von Mehrheitsentscheidungen (bei einer unbedingten Garantie des Minderheitenschutzes) zu verzichten. Die Frage, wann individuelle Interessen Vorrang vor kollektiven Interessen haben, muss ein demokratischer Staat letztlich immer im Einzelfall durch politische Aushandlungsprozesse beantworten. Als Grundregel kann jedoch festgehalten werden, dass dort wo der Dualismus zwischen Staat und Gesellschaft in Konflikt steht und sich in der Folge Staatlichkeit und Zivilgesellschaft im Dissens gegenüberstehen, das demokratische Funktionieren eines jeweiligen Staates am klarsten messen lässt.
Der freiheitliche und gerechte Staat unserer Vorstellung erträgt Widerspruch nicht nur, er fördert ihn, weil er sich darüber bewusst ist, dass die Grundlage eines pluralistisch-demokratischen Staates nicht von diesem Staat selbst, sondern nur durch die Zivilgesellschaft gelegt werden kann. Der Staat hat für uns dabei auch immer einen fürsorgenden Charakter und soll allen Staatsbürger*innen eine wesentliche Grundsicherung bieten
Der kritische Staat unser Vorstellung muss sich selbst der größte Skeptiker sein, deswegen beschränkt er die Ausübung des eigenen Gewaltmonopols durch einen breit ausgebauten Rechtsstaat, der dem Individuum ernsthafte Verteidigungswerkzeuge zur Hand gibt und klare Bereiche benennt, die dem Zugriff des Staates absolut entzogen sind.
Der zurückhaltende Staat unser Vorstellung akzeptiert das Bedürfnis von Menschen unbehelligt vom Staat zu leben und gewährt bis zu einem gewissen grad ein Recht auf staatsfernes Leben. Das heißt für uns, dass Menschen, die nicht in Konflikt zur aktuellen staatlichen Ordnung stehen, ein Recht darauf haben, vom Staat unbehelligt zu leben (z.B. Videoüberwachung). In diesem Kontext streben wir eine Abschaffung des Verfassungsschutzes in seiner jetzigen Form an.
Antifaschismus ist zentraler Bestandteil unserer jungsozialistischen Identität. Für uns ist Antifaschismus eine universelle, aber auch aus der deutschen Geschichte heraus eine besondere Verantwortung. Gerade in den letzten Jahren sind organisierte rechte Gruppierungen, wie beispielsweise die Identitäre Bewegung, oder Parteien wie die AfD, generell in Europa als auch global, mit ihren Nationalismen, Ausländerfeindlichkeiten sowie geschichtsrevisionistische Darstellungen erstarkt. Rechtes und faschistisches Gedankengut sind jedoch keine neuen Erscheinungen der vergangenen Jahre, sondern ziehen sich vor allem durch die deutsche Geschichte. Besonders die AfD gibt dieser Ideologie zum jetzigen Zeitpunkt ein bürgerliches Erscheinungsbild und Sprachrohr und reicht auf diese Weise mit ihren Menschenfeindlichkeiten weiter als in den Jahren zuvor in unsere Gesellschaft hinein. Rechte Gewalt ist jedoch kein Novum oder gar lediglich ein Trend, sondern ein eindeutig wachsendes Problem, welchem wir uns weiterhin entschieden entgegenstellen. Auch wenn Antifaschismus und das Einstehen für eine demokratische, offene, freie und solidarische Gesellschaft zusehends individuell sowie strukturell unter Druck geraten, steht für uns fest “Keinen Fußbreit dem Faschismus -keinen Millimeter nach rechts”. Wir verstehen unser antifaschistisches Engagement als Akt der Verteidigung gegen menschenfeindliche und antidemokratische Kräfte jeglicher Art. Wir stellen uns rechten Gruppierungen, insbesondere den ins bürgerliche Spektrum hinein wirkenden wie der sogenannten Identitären Bewegung und der AFD, überall entgegen. Ihre Aktionen und Inhalte bleiben niemals unwidersprochen. Wir engagieren uns im Gegenprotest und stellen ihrer rechten Ideologie zu jeder Zeit unserer Idee einer solidarischen, offenen und gerechten Gesellschaft entgegen. Zugleich müssen wir anerkennen, dass es auch unsere Generation ist, die der AfD in manchen Teilen Deutschlands zum Erfolg verhilft und sie mehrheitlich wählt. Diesen Zustand wollen und können wir nicht akzeptieren, weshalb wir unser antifaschistisches Engagement dahingehend hinterfragen und neue Wege finden müssen, junge Menschen von unserer Idee einer anderen Gesellschaft zu überzeugen.
In unserem antifaschistischen Engagement sind wir nicht alleine. Wir organisieren uns in breiten antifaschistischen Bündnissen und organisieren uns gemeinsam mit unseren Partner*innen im Kampf gegen Rechts und den Faschismus. Denn wir sind davon überzeugt, dass nur wenn Menschen zusammenstehen und Solidarität gelebt wird, faschistischen Kräften ein Ende gesetzt werden kann. Deshalb bringen wir unsere Entgegnungen, unsere solidarischen, offenen und gerechten Ideen gemeinsam auf die Straße, ins Netz und in die Gesellschaft. Unser gemeinsamer Kampf gegen Rechts muss jedoch dabei immer im Einklang unserer Solidarität mit Israel und dem Kampf gegen jeden Antisemitismus sein. Dies gilt auch für unsere antifaschistischen Bündnisse. Auch die gesellschaftliche und politische Linke ist von Antisemitismus nicht frei. Sowohl in bestehenden, als auch in zukünftigen Bündnissen, wollen wir vor diesem Hintergrund immer wieder auf unsere nicht verhandelbare Haltung gegen Antisemitismus hinweisen und dafür einstehen.
Unser Antifaschismus ist feministisch und unser Feminismus ist antifaschistisch! Wir denken Feminismus als Querschnittsthema in der Strukturierung unserer antifaschistischen Arbeit. Es ist uns bewusst, dass antifaschistische Strukturen oft männlich dominiert sind. Diese Strukturen müssen wir kritisch reflektieren und verändern, um so Räume zu schaffen, in denen Frauen in ihrem antifaschistischen Engagement empowert werden. Gerade in Anbetracht der stärker werdenden organisierten Antifeministinnen und ihre Vernetzung und enge Zusammenarbeit mit der neuen Rechten und europäischen Faschist*innen werden wir aufzeigen, wo Feminismus für rassistische Propaganda missbraucht wird. Wir decken den Antifeminismus der Rechten konsequent auf.
Antifaschistische Arbeit ist für uns immer auch Bildungsarbeit! Die generelle politische und historische Bildung junger Menschen und ihre demokratische Erziehung auf allen Ebenen ist die nachhaltigste Prävention gegen Faschismus. Aber auch demokratische Erwachsenenbildung und die fortschreitende Demokratisierung unserer Gesellschaft soll von uns gefördert werden, damit nachhaltig wehrhafte Strukturen gegen faschistische und antidemokratische Kräfte gebildet werden.
Demokratie muss man lernen. In den Schulen wollen wir die liberalen Werte unseres demokratischen Rechtsstaats an die nächsten Generationen weitergeben. Dazu wollen wir alle Schulen demokratisieren und antifaschistische Arbeit zum natürlichen Teil jeder Schüler*innenmitverwaltung machen. Darüber hinaus müssen die Gefahren von Faschismus und Totalitarismus damals wie heute in allen Lehrplänen thematisiert und behandelt werden.
Wir pflegen im Kampf und der demokratischen Bildung gegen Rechts besonders die Kontakte zu hochschulpolitischen Akteur*innen und namentlich den Juso-Hochschulgruppen, die eine bedeutende Kraft gegen die Umtriebe der sogenannten Identitären Bewegung, der JA und den rechten Burschenschaften an den Hochschulen und in den Unistädten sind und sich seit Jahren der politischen Aufklärung über und dem Kampf gegen studentische Verbindungen verschrieben haben.
Wir stellen uns rechtsextremistischem und faschistischem Gedankengut immer und überall entgegen. Sei es im Alltag, in der Freizeit oder während der Arbeitszeit. Rassistischen, xenophoben oder anderen diskriminierenden Äußerungen widersprechen wir klar, egal ob sie von Kolleginnen oder Chefinnen kommen. Wir unterstützen die Gewerkschaften und Betriebsräte bei ihrer antifaschistischen Arbeit.
Der Unvereinbarkeitsbeschluss, den die SPD bzgl. Burschenschaftern aus dem Dachverband der Deutschen Burschenschaft getroffen hat, ist insb. im Lichte der Verstrickungen in die neue Rechte weiterhin richtig und wichtig. Wir fordern die Erweiterung dieses Beschlusses auf all jene Studierendenverbindungen, die durch ihre Struktur und Rituale Nährböden rechter Ideologien sein können und unserem modernen und emanzipatorischen Weltbild entgegenstehen.
In den letzten Jahren ist der Druck von Rechten auf unsere demokratische Gesellschaft spürbar gewachsen. Darüber hinaus sehen wir uns mit neu formierten Gruppierungen und Strategien der neuen Rechten konfrontiert, welche bisher massiv unterschätzt werden. Wir können daher die Gefahr, die durch die „Neue Rechte“ als Bedrohung unserer demokratischen Gesellschaft entsteht, nicht ernst genug nehmen. Einerseits müssen dazu die Verstrickungen zwischen den einzeln agierenden Gruppen innerhalb der neuen Rechten aufgedeckt und öffentlich gemacht werden. Andererseits braucht es zusätzlich umfassende und langfristige Unterstützung für Präventions-und Aussteiger*innenangebote. Wir beobachten mit großer Sorge die zunehmende Bewaffnung rechter Gruppierungen und Netzwerke. Diesem Trend gilt es sich entgegenzustellen und diese so schnell wie möglich zu entwaffnen.
Die AfD ist eine antidemokratische und rechtsradikale und in Teilen faschistische Partei, mit der sich jegliche Zusammenarbeit und Annäherung verbietet. Die Radikalisierung und die eindeutige geschichtsrevisionistische und nationalistische Positionierung der AfD durch “den Flügel” ist nicht mehr zu leugnen. Es steht fest: Wer AfD wählt, wählt Nazis. Aufgrund dieser nicht anhaltenden Entwicklungen und der Verbindungen rechtsradikaler Gewalttaten mit der AfD ist es weiterhin dringend geboten diese Partei und ihre Jugendorganisation, die JA, unter Beobachtung der staatlichen Sicherheitsbehörden zu stellen. Darüber hinaus grenzen wir uns weiterhin mit harter Linie von der AfD ab und entlarven weiterhin ihren Nationalismus und Rassismus in jedem notwendigen Moment. Um dieses Ziel zu erreichen, dürfen wir den Funktionär*innen der AfD keine unnötige Bühne geben. Dafür ist auch der Boykott von Diskussionsveranstaltungen, an welchen dieses teilnehmen, ein legitimes Mittel. Wir fordern von der SPD, sich in diesem kompromisslosen Umgang ebenfalls weiterhin treu zu bleiben. Dies bedeutet, dass wir in allen Parlamenten keinen Anträgen rechtsextremer und völkischer Parteien zustimmen und allen ihren Kandidierenden eine klare Absage erteilen. Verstöße gegen diese Linie müssen innerparteilich Sanktioniert werden.
Neuorganisation von Reproduktionsarbeit heißt unter anderem auch, alle heute unbezahlte Care-Arbeit als zentrale gesellschaftliche Aufgabe zu begreifen. Dafür muss diese zum Teil in Erwerbsarbeit überführt und damit professionalisiert werden. Dadurch wird eine hochwertige und gut ausgebaute Care-Infrastruktur geschaffen, die staatlich organisiert und keinen ökonomischen Zwängen unterworfen sein darf. Nicht alle Care-Arbeit kann oder soll erwerbsförmig organisiert werden, trotzdem muss auch diese unbezahlte Care-Arbeit geschlechtergerecht umverteilt werden. Gleichzeitig wollen wir individuelle Wahlfreiheit für jeden. Dafür müssen wir staatliche Rahmenbedingungen schaffen, zentral ist dabei: die steuerliche Bevorzugung vom „Ernährer und Zuverdienerinnenmodel“ abzuschaffen, die weitestgehend verpflichtend paritätische Aufteilung der Elternzeit umsetzen und die Arbeitszeitverkürzung auf mittelfristig 25 Wochenstunden bei vollem Lohn-und Personalausgleich-durchzusetzen.
Frauen werden im Berufsleben immer noch als potentielle Mütter diskriminiert. Das Argument, dass Frauen Kinder bekommen könnten wird verbunden mit der Erwartung, dass damit eine Berufspause durch Elternzeit entsteht und im Verlauf durch andere Care-Aufgaben Frauen weniger engagiert in der Erwerbstätigkeit wären. Bei Einstellung oder Beförderungen, bei der Verteilung von besonderen Aufgaben oder der Möglichkeiten zur Fort-und Weiterbildung schlägt sich diese Annahme in geringeren Chancen und Benachteiligung nieder. Auch diese Tatsache trägt bei zur strukturellen Lohnungerechtigkeit. Der Gender Pay Gap beträgt im Jahr 2019 immer noch 21 Prozent. Selbst bei gleicher Qualifikation und gleicher Stundenzahl verdienen Frauen weniger als Männer. Echte Lohngerechtigkeit sieht anders aus. Das Konzept der Freiwilligkeit ist in den letzten Jahren hier eindeutig gescheitert. Lohngerechtigkeit wird es nur mit verbindlichen, gesetzlichen Regeln geben. Zu diesen verbindlichen Regeln gehört auch ein echtes Recht auf Entgeltgleichheit. Es braucht dafür eine gesetzliche Grundlage, auf deren Basis gleiche oder gleichwertige Arbeit auch tatsächlich gleich bezahlt werden muss. Für einen Kulturwandel in der Chefinnenetage braucht es außerdem 50% Frauen* in Führungspositionen. Auch hier bedarf es einer gesetzlichen Regelung, die eine solche Quote für Unternehmen ab einer bestimmten Größe vorsieht. Der öffentliche Dienst sollte dabei eine Vorbildrolle einnehmen, aktuell erfüllt er diese nicht. Insbesondere Führungspositionen werden nicht paritätisch besetzt und stereotype Berufsbildern wird an viel zu vielen Stellen auch bei der Neueinstellung entsprochen. Auch um das zu ändern braucht es eine durchsetzbare gesetzliche Grundlage.
Feminismus geht auch Männer etwas an. Die Geschlechterordnung im Patriarchat ist hierarchisch und basiert auf der Unterdrückung der Frau. Rollenzuschreibungen beginnen bereits im Kindesalter. Während Frauen und Mädchen als zukünftige Mütter und Care-Arbeitende sozialisiert werden, müssen Männer und Jungen stereotype Vorstellungen von Männlichkeit unter Beweis stellen. Auch im Schulunterricht werden immer noch Geschlechterstereotype bestärkt. Insbesondere im Sexualkundeunterricht kommen Themen wie Homosexualität, die Anatomie der Frau oder eine kritische Bezugnahme auf das Bild was Pornographie von Sexualität oftmals vermittelt kaum vor. Eine solche Sozialisation reproduziert kritische Vorbilder. Die in unserer Gesellschaft vorherrschende Vorstellung von Männlichkeit ist voller Stereotype und unerreichbarer Verhaltensideale für Männer. Männlichkeit muss durch den Mann immer wieder aufs Neue bewiesen werden, um nicht als „weiblich“ abgewertet zu werden. Um diese toxische Männlichkeit zu überwinden, müssen wir dafür sorgen, dass Geschlechterstereotype überwunden werden. Denn Geschlechterverhältnisse sind patriarchale Machtverhältnisse. Es muss Schluss sein mit den zahlreichen Vorschriften für Frauen. “Geh nicht alleine nach Hause”, “Trink nicht zu viel”, „Sei nicht so vorlaut“, “Dein Rock ist zu kurz”. Männer müssen Männlichkeit und Machtverhältnisse reflektieren. Außerdem muss sich etwas daran ändern was wir lernen und& wie wir aufwachsen. Für die freie und gleiche, menschliche Gesellschaft sind alle Menschen verantwortlich. Es bleibt: Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden.
Physisch, sexuell, psychisch, emotional, Gewalt gegen Frauen kennt viele Formen. Weltweit sind Frauen auf unterschiedliche Art und Weise von Gewalt betroffen welche sich in patriarchalischen Strukturen manifestiert und gleichlaufend durch diese bedingt wird. Noch immer herrscht das Bild vom fremden Mannim dunklen Park vor, dabei ist häusliche Gewalt, also die Gewalt durch einen (Ex-)Partner, Angehörige, Familie oder enge Freunde, in Deutschland am häufigsten. Gewalt gegen Frauen strukturell sowie individuell zu bekämpfen ist integraler Bestandteil unseres Feminismus. Dazu gehört ein gesellschaftlicher Wandel, aber eben auch ganz akut Hilfe zur Verfügung zu stellen. Ausreichend und ausfinanzierte Frauenhäuser sind dabei ein wichtiger Schritt, Anschlussprogramme müssen entwickelt werden Die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen muss insgesamt gestärkt werden, nicht zuletzt auch damit der Schritt aus gewalttätigen Beziehungen nicht zusätzlich versperrt wird. Für uns ist dabei inakzeptabel, dass Frauen*, die nicht ALG II berechtigt sind selbst für ihren Aufenthalt in den Einrichtungen aufkommen müssen. Aber auch der gesellschaftliche und vor allem mediale Umgang mit den Verbrechen muss sich ändern, noch immer werden Taten durch irreführende Bezeichnungen wie “Beziehungsdrama” verharmlost, Betroffene werden für die ihnen zugefügten Taten mitverantwortlich gemacht und Täter dabei aus der Verantwortung gelassen. Juristisch muss sichergestellt werden, dass Betroffene Gehör finden und nicht zusätzlich traumatisiert werden. Wo nötig muss das Strafrecht weiter reformiert werden. Das gilt zum einen für Stalkingopfer, diese sind den Tätern häufig schutzlos ausgeliefert. Daneben braucht es auch für Betroffene von Gewalt und Hatespeech im Netz wirksame strafrechtliche Regelungen.
Noch immer sind Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland illegal und nur unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Das Recht der Frau über ihren eigenen Körper zu entscheiden und eine selbstbestimmte Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Familienplanung treffen zu können, ist dadurch immer noch stark eingeschränkt. Um die Stigmatisierung und Kriminalisierung zu beenden, muss es endlich Informationsfreiheit über Schwangerschaftsabbrüche geben und sie müssen raus aus dem Strafgesetzbuch. Auch der Zugang zu nicht diskriminierender Sexualaufklärung und der Zugang zu kostenfreien, also kassenfinanzierten Verhütungsmitteln, gehören für uns zur sexuellen Selbstbestimmung dazu. Darüber hinaus muss umfassende Selbstbestimmung auch beinhalten, dass Gesundheitsversorgung diskriminierungsfrei werden muss. Medizinische Forschung muss erkrankte Frauen, genauso untersuchen, wie Männer* und gegebenenfalls geschlechtsspezifische Unterschiede berücksichtigen. Hierfür ist es nötig erheblich höhere Mittel in die Forschung zu investieren. Außerdem sollen geschlechtsspezifische Medizin und Pharmazie Teil der grundlegenden Lehre an Hochschulen und in der Ausbildung von Pflegekräften und Sanitätern werden. Dafür müssen Stereotype Rollenbilder sowohl in der Diagnostik, wie auch in der Therapie abgebaut werden.
Hunger-und Klimakatastrophen sowie Armut müssen als Fluchtgrund in die UN-Flüchtlingskonvention aufgenommen werden. Zudem müssen Kriegshandlungen und Menschenrechtsverletzungen als Fluchtgrund in die UN-Flüchtlingskonvention aufgenommen werden.
Es muss eine humanitäre Visafreiheit eingeführt werden. Jeder Grenzübertritt – ob auf dem Land-, See und Luftweg – mit dem Ziel, in einem Staat einen Asylantrag zu stellen, muss legalisiert sein. Diese Regelung muss die Durchreise einschließen. Die Europäische Union muss mit der Bereitstellung humanitärer Visa zur legalen Einreise in die EU und zur Übernahme der Reisekosten beginnen. Bis zum Zeitpunkt einer Einigung auf EU-Ebene muss die deutsche Bundesregierung eine entsprechend hohe Anzahl von Visa für die Einreise nach Deutschland zur Verfügung stellen und den sicheren Transport in die Europäische Union organisieren und finanzieren. Die humanitären Visa sind gebührenfrei und unbürokratisch in den Botschaften und Konsulaten zu gewähren. Dafür müssen die nötigen personellen Aufstockungen in den Botschaften so schnell wie möglich umgesetzt werden, um die Wartezeiten zu minimieren. Die Familienzusammenführung von geflüchteten Personen ist umgehend wieder aufzunehmen und ebenfalls schnell und unbürokratisch über die Vergabe humanitärer Visa zu ermöglichen.
Migration ist nicht zuletzt ein Ausdruck einer nicht vorhandenen Verteilungsgerechtigkeit. Solange es Ungleichheit gibt, werden Menschen versuchen ihren Lebensstatus zu verbessern. Die jahrzehntelange Ausbeutung von Arbeitnehmer*innen durch europäische Konzerne, deren Rohstoffhunger sowie eine menschenverachtende neoliberale Wirtschaftspolitik führen dazu, dass die lokale Lebensgrundlage systematisch zerstört wird. Der vor allem von den Industrieländern verursachte Klimawandel tut dabei den Rest. Die europäische Grenzschutzagentur FRONTEX muss unverzüglich abgeschafft werden. Sie steht für die menschenrechtswidrige und militarisierte Grenzabschottung der EU. Da die Agentur zudem nicht demokratisch kontrolliert werden kann, bleibt nur die gänzliche Auflösung. Die Wiedereinsetzung einer Europäische Seenotrettungsmission nach dem Vorbild der Mission „Mare Nostrum“ muss umgehend ermöglicht werden und zwar mit zusätzlichen Mitteln und Finanzen. Es ist Aufgabe der Europäischen Union sicherzustellen, dass ihre Außengrenzen nicht zum Massengrab werden. In der derzeitigen Situation ist dies nur mit einer staatlich organisierten Seenotrettung möglich. Die Staaten mit südlicher EU-Außengrenze können die Integration von tausenden Geflüchteten nicht alleine schultern. Die aus Seenot geretteten Flüchtenden müssen auf die europäischen Kommunen verteilt werden, die unabhängig von ihrer nationalen Regierung bereit dazu sind, Geflüchtete aufzunehmen. Diese solidarischen Kommunen müssen von der EU mit Geldern für die Integration der Geflüchteten und mit Mitteln für Infrastrukturmaßnahmen unterstützt werden. Außerdem müssen für Unterbringung, Betreuung und Asylverfahren EU-weite Mindeststandards gelten.
Die Kriminalisierung von humanitärer Hilfe auf dem Mittelmeer durch die Bundesregierung und insbesondere das Innenministerium muss beendet werden. Es müssen Sicherheitsgarantien für die im Mittelmeer operierenden NGOs durch die Europäische Union und Deutsche Bundesregierung eingeführt und eingehalten werden. Keine humanitäre Organisation darf dazu gezwungen werden, bewaffnetes Personal an Bord zu nehmen. Es kann unter keinen Umständen gerechtfertigt sein, dass ein Teil der Menschheit ihr Leben riskieren muss, um Grenzen zu überwinden, während ein privilegierter Teil, genauso wie Waren und Kapital, sich grenzenlos bewegen kann. Eine Welt ohne Grenzen ist möglich.
Wir brauchen eine ehrliche Diskussion über die Maßnahmen zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Gerade die SPD muss als Partei der internationalen Solidarität stärker die Wechselwirkung zwischen dem deutschen Engagement im Ausland, gerade in der Handelspolitik sowie bei ihren wirtschaftlichen Beziehungen, und Fluchtbewegungen in die Europäische Union thematisieren. Wir fordern in diesem Zusammenhang nachhaltigen Handel statt Freihandel und ein Ende der Zusammenarbeit mit Autokraten, Diktatoren und Nichtstaatlichen Akteuren, die Geflüchtete an der Einreise nach Europa hindern sollen. Aktionistische, von der SPD zumindest mitgetragene Gesetze zur Abschiebung von Geflüchteten im Nachgang von Zeiten mit hohen Flüchtlingsbewegungen, müssen allgemeinen Konzepten der Bekämpfung von globalen Ungleichheiten weichen. Deutschland als Einwanderungsland ohne Nützlichkeitsprinzip: In der Geschichte hat sich sehr klar herausgestellt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, in welchem Menschen aus allen Regionen der Erde leben und aus den unterschiedlichsten Gründen neu hinzukommen. Einwanderungshürden nach Nützlichkeitsprinzip wie etwa Punktesysteme lehnen wir strikt ab. Hierzu gehören auch explizit Gesetze, die den Kenntnisstand der deutsche Sprache und Bildungsabschlüsse zur Vorbedingung für eine Erlaubnis zur Einwanderung machen. Teilhabe und kulturelle Vielfalt in der Einwanderungsgesellschaft schaffen: Teilhabe und soziale Rechte für alle hier lebenden Menschen, zum Beispiel in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Bildung, sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Insbesondere müssen die Unterstützungsleistungen zum Spracherwerb und der Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen dringend verbessert werden. Wir wollen die verschiedenen Kulturen und Talente-bei gleichzeitiger Annäherung sowohl der Menschen mit Migrationshintergrund, wie auch der Aufnahmegesellschaft-als Chance begreifen, um die Gesellschaft vielfältiger und offener zu gestalten. Gesellschaftliches Zusammenleben braucht von allen Teilen der Gesellschaft einen Beitrag, deswegen lehnen wir einseitige Forderungen nach der gesellschaftlichen Integration ab und stellen uns gegen das Prinzip der Assimilation. Solange es keine europäische oder weltweite Staatsbürger*innenschaft gibt, muss für alle Menschen die Mehrstaatlichkeit ermöglicht und sowohl aktives wie auch passives Wahlrecht für alle in Deutschland lebenden ermöglicht werden.
Diskriminierung gehört in der Bundesrepublik zum Alltag von Menschen mit Migrationshintergrund. Der Staat muss alles Mögliche tun, um dies zu bekämpfen. Hierzu ist es dringend notwendig, dass alle staatlichen Ebenen diverser besetzt und strukturelle Diskriminierungen sofort beendet wird. Dazu braucht es staatliche Förderprogramme für die Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund und eine Initiative um das Problem des Alltagsrassismus anzugehen. Letzteres muss besonders auch in den Lehrplänen thematisiert werden, um eine frühe Sensibilisierung mit der Thematik zu erreichen. Ferner, muss auch innerhalb der SPD ein Konzept für die interkulturelle Öffnung von Parteien erarbeitet werden.
Der Zugang zum Internet und die damit einhergehende Möglichkeit zu kommunizieren und sich zu informieren, ist für uns Bestandteil der Daseinsvorsorge. Gesellschaftliche Teilhabe kann heute nicht mehr ausschließlich offline gedacht werden. Deswegen ist es staatliche Aufgabe, überall in der Bundesrepublik, den Zugang für alle Menschen zum Internet zu gewährleisten. Dabei setzen wir uns dafür ein, dass auch in ländlichen Regionen Glasfaseranbindungen bestehen und moderne Netzstandards überall verfügbar sind. Dies ist für uns eine wesentliche Frage der Gewährleistung gleicher Lebenschancen. Teilhabe heißt auch, dass alle Menschen Angebote gleichberechtigt und selbstständig nutzen können. Das gilt auch im Netz. Deshalb muss Ziel sein, digitale Inhalte grundsätzlich barrierefrei zugänglich zu machen.
Wenn das Netz ein Raum der Freiheit, Gleichheit und der Chancen für alle Menschen sein soll, verträgt sich das nicht mit einer Ungleichbehandlung verschiedener Daten. Deshalb fordern wir die Verankerung der Netzneutralität im Grundgesetz, insofern dass keine Zugangsanbieterinnen nach inhaltlichen Kriterien Einfluss auf Verfügbarkeit, Priorisierung oder Bandbreite der weitergeleiteten Daten nehmen darf. Einflussnahme darf nur als akzeptabel betrachtet werden, wenn Transparenz gewahrt und ein tatsächlicher Kapazitätsengpass besteht. Der Einsatz von Deep Packet Inspection (DPI) ist abzulehnen.
Persönliche Daten im Internet müssen geschützt werden. Eine Erhebung darf niemals ohne vorheriges Einverständnis geschehen. Die Anbieterinnen dürfen nur solche Daten erheben, die für den Zweck der Nutzung erforderlich sind. Der Schutz der Daten muss sich dabei am Wohnsitz der Nutzerinnen, nicht am Firmensitz orientieren. Jeder hat das Recht auf Verschlüsselung seiner Daten frei von staatlichen Eingriffen. Die Weiterverwertung von persönlichen Daten darf auch bei Zustimmung nur beschränkt möglich sein und muss kontrolliert werden. „Eine kapitalistische Verwertung persönlicher Daten lehnen wir ab.
Das Internet, insbesondere soziale Netzwerke haben sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Diskursräume moderner Demokratien entwickelt. Die Regeln für diese Räume setzen die privaten Netzwerkbetreiber*innen in ihren AGBs. Dabei zeigen sie sich extrem restriktiv gegenüber Nacktheit und äußerst liberal gegenüber Hate Speech, Anfeindungen und rechter Propaganda. Alle Rechte, insbesondere Grundrechte, müssen auch in sozialen Netzen Geltung entfalten. Wir wollen soziale Netzwerke als öffentlichen Diskursraum sichern, in dem Grundrechte nicht privatautonom abbedungen werden können. Langfristig glauben wir, dass der Diskurs im Netz auf vergesellschafteten Plattformen stattfinden muss.
Straftaten im Netz müssen staatlich verfolgt und geahndet werden. Auch in sozialen Netzwerken kann diese Aufgabe nicht allein von den Betreiberinnen wahrgenommen werden. Unser Weg ist es dabei, nicht die Kompetenzen der Polizei immer weiter auszuweiten. Wir glauben, dass die Befugnisse der Polizei ausreichend sind und in den letzten Jahren eher überdehnt wurden. Wir setzen uns deshalb für eine bessere personelle Ausstattung und Schulung von Polizei und Justiz ein, um Straftaten im Netz effektiv zu bekämpfen. Algorithmen Grenzen setzen: Algorithmen übernehmen zunehmend Entscheidungen und Auswahlprozesse in unserem Alltag. Beispielsweise in Sozialen Netzwerken entfalten sie mit ihrer Funktionsweise enorme Auswirkungen auf die Diskurse unserer Gesellschaft. Daten, mit denen Künstliche Intelligenz (KI) gespeist wird, bilden unsere Gesellschaft und reproduzieren so vorhandene Diskriminierung sogar noch unter dem Deckmantel einer vermeintlichen Objektivität. Deswegen bedarf es eines Algorithmusgleichbehandlungsgesetzes, welches dies verhindert. Die Parameter müssen von Algorithmen nachvollziehbar offengelegt werden, um eine gesellschaftliche Debatte darüber zu ermöglichen. Dadurch kann beispielsweise eine Ungleichbehandlung von Konsumentinnen, etwa durch sich algorithmisch individuell anpassende Preise, aufgedeckt und verboten werden. Durch automatisierte Entscheidungen stellen sich eine Vielfalt von neuen ethischen Fragen. Nur wenn die Funktion von Algorithmen offen gelegt wird, kann ein gesellschaftlicher Diskurs über moralische Grenzen überhaupt stattfinden.
Was für uns für dingliches Eigentum gilt, gilt für uns auch für digitales. Es soll für möglichst viele Menschen nutzbar sein. Deswegen begrüßen wir eine freie Sharing-Kultur und wollen diese ermöglichen. Gleichzeitig wollen wir die Urheberinnen möglichst direkt entlohnen. Deswegen wollen wir, dass die Plattformanbieterinnen gesetzlich gezwungen werden, mit den Urheberinnen faire Vergütungsverträge abzuschließen. Andernfalls sollen die Plattformunternehmen entsprechend besteuert und eine faire Vergütung der Urheberinnen staatlich gewährleistet werden. Uploadfilter und ähnliche Zensurmechanismen lehnen wir ab. Darüber hinaus halten wir Creative-Commons-Lizenzen für eine sinnvolle Weiterentwicklung des Urheberrechts und setzen uns als Jusos für eine weitere Stärkung des Systems der CC-Lizenzen ein. Das Urheberrecht ist jedoch nur so stark, wie es bekannt ist. Für mehr Aufklärung setzen wir uns weiterhin ein.
Das Klima wandelt sich bereits seit Jahrhunderten. Der menschliche Beitrag zu diesem Wandel hat in den letzten 200 Jahren allerdings deutlich zugenommen. Diese durch den Menschen verursachten Umweltbelastungen und -verschmutzungen haben bereits heute teils irreparable Auswirkungen. Die Folgen beeinflussen die Lebensverhältnisse zahlloser Menschen, aber auch Tiere, Vegetation und letztlich das gesamte Natur-und Ökosystem weltweit sind betroffen. Von Jahr zu Jahr wird die Erde heißer und von Jahr zu Jahr wird der Kampf gegen die Klimaerwärmung drängender.Dementsprechend ist die Umwelt-und Klimapolitik heute umkämpfter denn je. Auf der einen Seite bestreiten reaktionäre Kräfte und rechtspopulistische Parteien den Klimawandel. Auf der anderen Seite werden sich immer mehr Menschen der planetaren Grenzen bewusst und versuchen dem durch individuelles Konsumverhalten gegenzusteuern. Der Kampf derjenigen, die sich der Endlichkeit unserer Ressourcen bewusst sind, insbesondere unserer Generation, wird immer intensiver. Der Klimawandel sowie die Verknappung von Ressourcen sind, wenn wir Wohlstand sichern und Fortschritt ermöglichen wollen, die Herausforderungen unserer Zeit. Demzufolge stellt die Energiewende eine politische Notwendigkeit dar und ist das zivilisatorische Jahrhundertprojekt.
Dabei sind Ökologie und Ökonomie kein Widerspruch: Wenn wir beides zusammen denken, können wir langfristig das Klima schützen, intakte Ökosysteme sichern und Produktions-und Industriestandorte erhalten und ausbauen. Dies wird jedoch nur gelingen, wenn wir es schaffen die Energieversorgung als zentralen Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge wieder in staatliche Kontrolle zu überführen. Die Energiewende muss als ganzheitliches Projekt, das alle Sektoren von Strom, über Wärme und Verkehr bis hin zur notwendigen Infrastruktur in den Fokus nimmt, zusammen denkt und sie als Chance für eine Transformation unserer Wirtschaftsweise begreift, behandelt werden. Wir wollen bezahlbare Energie und Mobilität für alle Menschen. Klassenunterschiede dürfen durch die Energiewende und die Auswirkungen der Klimaveränderungen nicht weiter verschärft werden. Nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung, der vornehmlich in den westlichen Industrienationen lebt, ist für den Großteil des globalen Ressourcenverbrauchs und der globalen Umweltbelastungen verantwortlich. Europa steht hier in der Verantwortung auf das Einhalten der Ziele des Pariser Klimaabkommens zu drängen und die CO2 Reduktion massiv voranzutreiben durch Maßnahmen in den Bereichen Mobilität, Energie, Bauen, Landwirtschaft und Industrie. Um diesen Systemwandel gerecht zu gestalten müssen strukturschwache Regionen unterstützt werden. Zudem brauchen wir eine wertgebundene Handelspolitik auf Augenhöhe zu den Ländern des globalen Südens.
Ein politisches wie gesellschaftlich stark umkämpftes Thema ist dabei die Frage der Energieversorgung und des Umgangs mit fossilen Energieträgern. Die Sozialdemokratie hat hier als Schutzmacht von Arbeitnehmerinnen sowie als Vorkämpferin für globale Gerechtigkeit eine besondere Verantwortung, die wir als Jusos annehmen wollen. Uns ist bewusst, dass der Wandel im Energiesektor auch ein Wechsel von Marktanteilen ist und folglich auf den erbitterten Widerstand von großen Energiekonzernen stoßen wird. Wir sprechen uns dennoch für eine Energie-Revolution aus, die den Ausbau der erneuerbaren Energien unter Berücksichtigung der Folgen des damit einhergehenden Strukturwandels vorantreibt. Dazu müssen wir insbesondere die Stärkung kommunaler, bürgerinnengestützter und genossen*innenschaftlicher Energieversorgung in den Blick nehmen, um die Potentiale Erneuerbarer Energien voll auszuschöpfen. Deutschland muss mittelfristig seinen Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien decken. Wir wollen nicht nur konventionelle Energieträger sukzessiv zurückfahren, sondern insbesondere die Förderung des Ausbaus von Wind-und Wasserkraft, des Ausbaus von Photovoltaik und Solarthermie, der geothermischen Energiegewinnung, sowie Investitionen in Forschung und Entwicklung vorantreiben. Eine Schlüsselrolle kommt hierbei den Speichertechnologien zu; Pumpspeicherwerke, Power-to-X und Wärmespeicher sind nur einige Beispiele, die effizienter sind als Akkumulatoren. Wir müssen alles dafür tun, dass die Energiewende sozial und schnell geschieht. Dazu müssen die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden: Erstens ein wirklich tragfähiges Konzept für die betroffenen Regionen zur Umstrukturierung der Wirtschaft. Wir können uns keinen weiteren gescheiterten Strukturwandel leisten. Eine Deindustrialisierung muss dabei verhindert werden. Zweitens die Demokratisierung der Wirtschaft: Solange kapitalistische Interessen Vorrang vor dem Gemeinwohl haben, kann es keine nachhaltige, soziale und ökologische Transformation geben. Drittens massive Investitionen in den Umbau der Energieversorgung und Infrastruktur. Die Kosten müssen von denen getragen werden, die viel haben und geben können. Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen und ohne nennenswerte Vermögen müssen entlastet werden. Wenn diese Bedingungen nicht nur politische Lippenbekenntnisse sind, sondern mit konkreten Plänen und Maßnahmen unterlegt werden, dann unterstützen wir einen schnelleren Kohleausstieg bis 2030. Der Umstieg auf Erneuerbare Energien muss demokratisch und vor allem dezentral organisiert werden, um Oligopole einzelner Energiekonzerne zu überwinden.
Der Energieverbrauch in Gebäuden muss gesenkt werden und durch eine Verknüpfung des Strom-mit dem Wärmemarkt müssen Synergien bei der Nutzung erneuerbarer Energien entstehen. Über steuerlich finanzierte Zuschüsse und günstige öffentliche Darlehen können wir eine jährliche Sanierungsquote von mindestens 2,5% erreichen, um so energetischen Sanierung durch Dämmungen, Erneuerungen technischer Geräte, Solarthermie-und Lüftungsanlagen von privaten Gebäuden zu unterstützen. Zur Sanierung öffentlicher Gebäude wollen wir neben einem Fond für Kommunen auch Bürger*innen Energiespar Contracting-Modelle unterstützen.
Die CO2-Bepreisung kann einen effektiven Hebel darstellen, um gewünschte Entwicklungen zur Einsparung von Treibhausgasen beschleunigen zu können. Wir begrüßen die aktuellen sozialdemokratischen Bestrebungen zur Einführung einer CO2-Bepreisung. Im Angesicht der Dringlichkeit der Klimakrise müssen wir anerkennen, dass hierbei kleine Schritte keine adäquate Lösung sein können, sondern eine entschlossene und schnell wirksame Bepreisung zur Einschränkung der Emissionen nötig ist. Der soziale Ausgleich im Rahmen der Bepreisung darf dabei nicht als Nebenaspekt, sondern muss als zentraler Teil dieses Instruments behandelt werden. Diese Strategie wird jedoch nur aufgehen, wenn neben der Industrie auch die Bereiche Verkehr und Wärme in den Fokus genommen werden. Insbesondere der seit Jahren von der CSU verantwortete Verkehrssektor trägt heute noch viel zu wenig zu den notwendigen Einsparungen bei und ist auf den sich längst vollziehenden technologischen Wandel absolut unzureichend vorbereitet. Das gefährdet nicht nur das Klima, sondern auch die Arbeitsplätze der Zukunft.
Wir sprechen uns gegen die Förderpolitik von bestimmten industriellen Leuchttürmen oder “europäischen Champions” aus. Wir glauben an die Überlegenheit einer kleinteilig organisierten und flexiblen Wirtschaft. Deswegen setzen wir auch in der Industriepolitik auf Breitenförderung. Investitionen in Forschung und Entwicklung in wesentlichen Industriebereichen, die allen zugutekommen sind besser als eine einseitige Fokussierung auf bestimmte Unternehmen, die man zu internationalen Monopolisten aufbauen möchte. Auch wollen wir nicht die Fusionsregeln lockern, sondern mittels der Europäischen Wettbewerbsbehörde Monopolisierungstendenzen vorbeugen.
Wir setzen uns für eine gezielte Förderungsstrategie von grüner Technologie und entsprechenden Industriezweigen in Europa ein. Im Bereich Energiespeicherung, Energieerzeugung, moderne Antriebstechnologien (vor allem auch abseits der Batterietechnologie) liegt die Zukunft und wir brauchen Innovationen um unsere Klimaziele zu erfüllen. Deswegen wollen wir diese Bereiche gezielt fördern.
Viele Bereiche, gerade auch im Osten Deutschlands sind durch Fehlentscheidungen in der Vergangenheit weitgehend deindustrialisiert worden, was sich negativ auf die Einkommensverhältnisse und die Gesamtentwicklung der Regionen auswirkt. Wir setzen uns für den gezielten Aufbau neuer Industrien, Forschungszentren, etc. in diesen Regionen ein, um neue Perspektiven für die dort lebenden Menschen zu schaffen. Internationale Standards bei Umweltschutz und Arbeitnehmerinnenrechten: Wir setzen uns für internationale Standards in der Industrie bei Umweltschutz und Arbeitnehmerinnenrechten ein. Niemandem ist geholfen, wenn Auflagen durch Off-Shoring umgangen werden. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass möglichst gleiche Standards für den internationalen Wettbewerb gelten. Standards müssen europaweit auf ein möglichst hohes Niveau angeglichen werden und die EU muss bei ihrer Handelspolitik Wert auf die Einhaltung der Standards auch bei importierten Produkten legen, die für den einheimischen Markt bestimmt sind. Dazu ist die Einführung einer Treibhausgas-Grenzabgabe ein wichtiger und richtiger Schritt.
Wir setzen uns für eine langfristig orientierte Industriepolitik ein. In den vergangenen Jahrzehnten gab es entweder keine oder eine einseitig an den Interessen besonders gut vernetzter Lobbyist*innen orientierte Industriepolitik in der Bundesrepublik. Davon muss Abstand genommen werden. Industriepolitik muss lange Linien mit demokratischer Legitimation ziehen. Eine progressive Industriepolitik agiert nicht einfach ordnungspolitisch und beschränkt sich auf das Setzen von Leitplanken, sie greift aktiv ein und überlässt das Feld nicht den Kräften des freien Marktes.
Die Digitalisierung ist eine objektive Produktivkraftentwicklung. Sie ist aus sich heraus weder gut noch schlecht, sondern Ausdruck des gesellschaftlichen Fortschritts. Wir wollen diesen Fortschritt im Sinne der Gesamtgesellschaft statt im alleinigen Sinne der Kapitalist*innen nutzbar machen.
Aufgrund von Netzwerkeffekten haben digitale Märkte eine große Tendenz zur Monopolisierung. Riesige Plattformmonopolisten vereinigen nicht nur große Kapitalmengen auf sich, sondern auch erhebliche politische Macht. Häufig verdrängen sie alternative, gemeinwohlorientierte Konkurrentinnen. Wir setzen uns für eine staatliche Förderung alternativer, nicht gewinnorientierter Plattformunternehmen ein und wollen die Macht der Plattformriesen regulieren. Insbesondere im Bereich der sozialen Plattformen glauben wir, dass Profitorientierung sich mit dem eigentlichen Zweck dieser Unternehmen nicht verträgt und setzen uns für eine Vergesellschaftung ein. Die Form der Vergesellschaftung ist dabei differenziert nach Größe und Art des Unternehmens zu bestimmen und kann beispielsweise durch Überführung in öffentlich-rechtliche Trägerinnenschaft, genoss*innenschaftliche Strukturen oder staatliche Leitung geschehen.
Daten sind die Währung der Digitalisierung. Gleichzeitig werden sie vielfach in den Unternehmensbilanzen noch nicht wertmäßig erfasst und dementsprechend nicht besteuert. Wir setzen uns für eine wertmäßige Erfassung und eine steuerliche Berücksichtigung ein. Das europäische Wettbewerbsrecht muss reformiert werden, sodass auch der Wert eines Unternehmens in Form von Datensätzen als Bewertungskriterium bei der Übernahme von Firmen herangezogen wird.
Die Digitalisierung lebt von Daten. Viele dieser Daten sammeln sich bei den Plattformriesen, verschaffen diesen einen Vorteil und behindern die Entwicklung anderer Unternehmen. Deswegen fordern wir eine Freigabe und allgemeine Zurverfügungstellung anonymer oder anonymisierter Daten um auch kleinen Unternehmen eine Entwicklungschance zu geben. Öffentliche Daten müssen auch -soweit möglich-allen zur Verfügung gestellt werden. Digitalisierung zur Dezentralisierung und Mitbestimmung nutzen: Die Digitalisierung birgt das Potenzial, Unternehmensprozesse transparenter zu machen, Managementaufgaben zu übernehmen und Mitarbeiterinnen stärker einzubinden. Diese Erkenntnisse müssen allen Mitarbeiterinnen zur Verfügung gestellt werden und zur dezentralen und enthierarchisierten Steuerung von Unternehmen genutzt werden.
Die Digitalisierung von Verwaltungen bietet sowohl für Bürgerinnen als auch für die Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung große Chancen zur Vereinfachung der Strukturen und Abläufe der angebotenen Dienstleistungen. Verwaltungsabläufe sollen weitgehend digitalisiert werden, um die schnelle digitale Antragstellung zu ermöglichen und damit Barrieren zu senken. Darüber hinaus eröffnet die digitale Verwaltung neue Möglichkeiten der Bürgerinnenbeteiligug in öffentliche Projekte
Alle Schülerinnen in Deutschland sollten die gleichen Chancen bei der Bildung haben. Chancengleichheit bedeutet für uns das jeder unabhängig von ihremseinem Geschlecht, sexueller Identität und Orientierung sowie Behinderung, sozialen Herkunft und Migrationshintergrund die gleichen Chancen auf Bildung haben sollte. Das sehen wir als unser Grundverständnis in allen Lebensbereichen. Die Realität ist jedoch eine andere: Die Herkunft der Familie, der soziale Stand und der Abschluss der Eltern entscheiden immer noch maßgeblich über den Bildungserfolg der Kinder. So haben z. B. Kinder von Akademikerinnen bessere Chancen ein Abitur zu erreichen als Kinder von Arbeiter*innen. Auch in den PISA-Studien lässt sich der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft, Migrationshintergrund und den Ergebnissen erkennen: Das deutsche Schulsystem gehört laut PISA zu den Ungerechtesten weltweit. Deutschland ist im Punkt Bildung eine Zweiklassengesellschaft. Deswegen ist ein zentrales bildungspolitisches Ziel von uns, den Bildungserfolg weitestgehend von sozialen Faktoren zu entkoppeln.
Unser aktuelles Schulsystem mit der Trennung von Schülerinnen nach der vierten (bzw. sechsten) Klasse zementiert Chancenungleichheit und verbaut Bildungsbiografien. Die Bildungsforschung hat herausgestellt, dass die Trennung nach der vierten Klasse viel zu früh greift. Sie führt dazu, dass bereits in der Grundschule ein hoher Auslesedruck ausgeübt wird, welcher die scheinbare „Begabung“ von Schülerinnen alleine an ihrenseinen Noten in bestimmten Fächern festmacht. Dieses System sortiert in vielen Fällen aber nicht nach tatsächlichen Begabungen und Leistungen, sondern ist starr und betrachtet in der Regel vor allem die familiären Hintergründe. Ausdruck dessen ist, dass es bei gleichen Leistungen immer wieder zu einer Benachteiligung von Schülerinnen aus sozio-ökonomisch benachteiligten Familien bei der Vergabe von Gymnasialempfehlungen kommt. Darüber hinaus verstärkt eine Aufteilung nach Schulformen nur die Unterschiede zwischen den Schülerinnen. Schwächere Schülerinnen werden abgehängt, während stärkere Schülerinnen nur bedingt profitieren. Anstatt schwächere Schülerinnen durch das gemeinsame Lernen gezielt zu fördern, grenzt man diese aus und verhindert somit einen späteren Aufstieg. Dieses Schulsystem verankert bestehende Ungleichheit gleich am Anfang und zementiert bestehende Ungleichheiten. Der Bildungserfolg ist hier maßgeblich von schwer beeinflussbaren Faktoren abhängig. Wir Jusos setzen uns deshalb für die Einführung einer demokratischen Schule für alle ein! Die selektiv-sozialkonservative Schulstruktur aus vor-demokratischen Zeiten gehört überwunden. Nach einer vier-bis sechsjährigen Grundschule fordern wir den Übergang in integrierte Gesamtschulen, die alle Schülerinnen am Ende der Sekundarstufe I, also nach dem zehnten Schuljahr, zu einem ersten allgemeinbildenden Bildungsab schluss führen. Dieser Abschluss soll entweder den Weg in eine dreijährige Sekundarstufe II oder in die Berufsbildung ebnen. Dabei ist uns wichtig, dass die Änderungen der Schulstruktur durch demokratische Elemente ergänzt werden. Demokratie darf nicht nur lediglich Lerninhalt mancher Fächer sein, sondern muss im Schulalltag verankert und jederzeit erfahrbar sein. Alle Mitglieder der Schulfamilie müssen sich in den entsprechenden Gremien der Schule auf Augenhöhe begegnen können. Die Handlungsfelder der Gremien müssen breit angelegt sein, exemplarisch sind hier Lerninhalte oder die Gestaltung der Räumlichkeiten zu nennen. Schülerinnenvertretungen sind zu stärken. Wir fordern außerdem die flächendeckende Ausweitung von Ganztagsschulen, die für uns einen wichtigen Beitrag für mehr Chancengleichheit darstellen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken.
Die Schule für alle muss aus unserer Perspektive eine inklusive Schule sein, bei der Schülerinnen mit und ohne sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf gemeinsam unterrichtet werden. Wir Jusos sind uns bewusst, dass alle Menschen unterschiedlich sind. Schülerinnen mit und ohne Behinderung haben durch Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention den Anspruch auf Bildung an einer allgemeinen Schule. Um diesen Anspruch umzusetzen, muss bauliche und kommunikationsbetreffende Barrierefreiheit gewährleistet sein. Außerdem müssen alle Schülerinnen entsprechend ihrem individuellen Unterstützungsbedarf gefördert werden. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass an allen Schulen multiprofessionelle Teams das Lernen gestalten. Diese setzen sich aus Lehrkräften, Sonderpädagoginnen, Sozialarbeiterinnen, Schulpsychologinnen und weiteren pädagogischen Fachkräften entsprechend dem Bedarf zusammen. Wir begreifen Vielfalt als eine Bereicherung für die Gesellschaft. Von einem inklusiven Bildungssystem profitieren nicht nur Schülerinnen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, sondern alle. Beim gemeinsamen Lernen geht es nicht nur um kognitive Fähigkeiten, sondern auch um soziale Kompetenzen. Für uns steht deshalb die Förderschule im Widerspruch zu einem inklusiven Bildungssystem und widerspricht der von Deutschland ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention. Kinder dürfen aufgrund einer Beeinträchtigung vom Besuch einer Grundschule oder einer weiterführenden Schule nicht ausgeschlossen werden. Das Bildungssystem soll jeder und jedem* zugänglich sein. Das gemeinsame Unterrichten von beeinträchtigen und nicht beeinträchtigen Kindern in einer Regelschule stellt für uns das einzig richtige Konzept dar. In der Konsequenz fordern wir daher die komplette Abschaffung der Förderschule. Gleichzeitig müssen genug Mittel zur Verfügung gestellt werden, dass ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf (spezifische Hilfsmaterialien und zusätzliches Lehrpersonal mit sonderpädagogischer Ausbildung umfassend) in den inklusiven Schulen ausreichend gedeckt und gewährleistet werden kann. Lehrende sollen hierzu auch in ihrer Ausbildung sensibilisiert und in dem Bereich teilausgebildet werden.
Aktuell herrscht zwischen allen Bundesländern ein „Wettbewerb“ um das beste Bildungssystem. Dieser Wettbewerb erzeugt ungleiche Bildungschancen in allen Bundesländern und lässt oft den Standort der Schülerinnen darüber entscheiden, welche Bildungschancen sie haben. Je nach Bundesland oder gar Wohnort ergeben sich für die Schülerinnen unterschiedliche Zugänge zu den verschiedenen Bildungseinrichtungen und Schulkonzepten und dadurch ungleiche Bildungschancen. Vor besondere Schwierigkeiten stellt das föderalistische Schulsystem diejenigen Schüler*innen, die das Bundesland wechseln und plötzlich vor einem komplett anderen System stehen. Diesen Zustand halten wir für nicht tragbar. Aus diesem Grund wollen wir eine Debatte darüber, ob diese Form eines Bildungssystems noch zeitgemäß ist oder darüber, welche Regeln in einem föderalistischen System gelten müssen, um Chancengleichheit für alle zu garantieren.
Kompetenzen vermitteln für ein selbstbestimmtes Leben: Schulische Bildung soll Schüler*innen die Fähigkeiten und Fertigkeiten mitgeben, damit sie ein selbstbestimmtes Leben führen können. Um dieses Ziel zu erreichen, bleibt für uns die aktuell bereits praktizierte Kompetenzorientierung das zentrale Mittel. Deshalb sollen neben dem reinen Fachwissen in der Schule vor allem auch fächerübergreifende Kompetenzen erworben und gefördert werden. In einer sich immer schneller entwickelnden Gesellschaft steht hier vor allem die Fähigkeit im Mittelpunkt, sich selbst neue Inhalte anzueignen und diese zu nutzen. Zielführendes Arbeitsverhalten und Lernstrategien sind Grundlage für Lebenslanges Lernen. Doch nicht nur das inhaltliche und arbeitsorientierte Lernen, sondern auch das soziale Lernen soll in der Schule eine bedeutende Rolle spielen. Zwischenmenschliche Kommunikation, Diskussions-und Kritikfähigkeit, der Umgang mit Niederlagen oder Werte wie Solidarität und Gerechtigkeit müssen gelernt und erfahren werden.
Differenzierte Rückmeldung und Feedback sind für die Beobachtung des Lernerfolgs notwendig. Noten tragen wenig zu dieser wichtigen Reflexion des Wissensstandes bei. Objektivität in der Notengebung können Lehrkräfte aufgrund psychologischer Effekte wie der Reihenfolge der korrigierten Arbeiten auch bei größter Mühe niemals vollständig erreichen. Vor allem bei mündlichen Leistungserhebungen scheint die Notengebung oftmals willkürlich und kann kaum nachvollzogen werden. So ist bereits die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit einzelner Noten massiv eingeschränkt. Die daraus gebildete Gesamtnote stellt dann eine weitestgehend nichtssagende Zahl dar, die weder Rückschlüsse auf den Wissensstand der Schülerinnen noch auf eventuelle Übungsschwerpunkte ziehen lassen. Sie gaukelt eine Vergleichbarkeit in Zahlen vor, die in Wahrheit nicht besteht. Die Leistungsbemessung in Form von Noten erhöht darüber hinaus stetig den Leistungsdruck, da man als Schülerin weiß, dass jede Einzelnote Einfluss auf die Jahresendnote nimmt. Dauernde Bewertung in der Schule ohne Rücksicht auf die Lebenssituation der Schülerinnen baut Druck auf und verursacht dauerhaften Stress. Viele Kinder machen ihren persönlichen Wert von der zahlenmäßigen Bewertung ihrer Leistung abhängig. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die an psychischen Erkrankungen leiden, steigt kontinuierlich. Wir Jusos lehnen den Leistungsdruck in der Bildung ab. Wir sind überzeugt, dass Lernen nur dann einen langfristigen Effekt erzielt, wenn Schülerinnen dies aus eigenem Antrieb und nicht aufgrund von Druck von außen tun. Leistungsbewertung in Form von Noten lehnen wir deshalb ab. Statt Schülerinnen auf einer Skala einzuordnen, wollen wir schriftliche Bewertungen und differenzierte Lernfortschrittsgespräche, die von den Pädagoginnen geführt und dokumentiert werden. Kern der Lernentwicklungsgespräche ist nicht der Vergleich zwischen Schülerinnen, sondern der individuelle Lernfortschritt in den verschiedenen Themengebieten ebenso wie die Entwicklungspotentiale im jeweiligen Bereich. Aber auch andere Kompetenzen, Sozialverhalten, ehrenamtliches Engagement und besondere Fähigkeiten können in dieser Beurteilung aufgenommen werden. So bekommen die Schülerinnen und auch deren Eltern einen guten Eindruck der Fortschritte. Gleichzeitig fördern Feedbackgespräche die Selbsteinschätzung der Kinder und es können gemeinsam individuelle Lernziele erarbeitet und vereinbart werden.
Eine gute Bildung braucht gute Rahmenbedingungen. Lehrerinnen gestalten diese maßgeblich mit und sind selbst ein wesentlicher Faktor bei deren Gestaltung. Gegenwärtig wird allerdings landesweit der Mangel an Lehrkräften beklagt, der vielerorts das Einhalten regulärer Unterrichtspläne erschwert. Dieser Zustand ist für uns nicht tragbar. Wir fordern die vorausschauende Ausbildung und Einstellung von ausreichend Lehrkräften, die über das benötigte Mindestmaß hinausgeht, sodass auch bei Krankheitsfällen oder anders bedingten Ausfällen Unterrichtsausfall und übergroße Klassen vermieden werden. Darüber hinaus bringt die sich rasant verändernde Gesellschaft neue Anforderungen an die Lehrerinnenbildung mit sich. Die Digitalisierung erhält endlich auch an Schulen Einzug, woraus sich auch neue Methoden der Wissensvermittlung ergeben – ein Zustand, den die Lehrerinnenbildung sowohl in der universitären Ausbildung als auch in der Fort-und Weiterbildung weitgehend übersieht. Doch nicht nur im Bereich der Digitalisierung, auch in anderen Themenfeldern fordern wir eine Verbesserung der Lehrerinnenbildung. So muss die universitäre Lehrerinnenbildung stärker mit der Praxis verknüpft sein und die Lehrkräfte stärker in der Vermittlung von fächerübergreifenden Kompetenzen und Sozialkompetenzen schulen und ihnen Erziehungskompetenzen vermitteln. Auch für Lehrerinnen, die bereits im Berufsalltag stehen, müssen Fortbildungsangebote geschaffen werden, Damit sie für die sich stets verändernden Anforderungen gerüstet sind. Aktuell fehlt es aber an Fortbildungsangeboten für Lehrerinnen. Die GEW kritisiert diesen Zustand schon lange und fordert Investitionen in Qualität und Quantität von Fortbildungsangeboten. Das persönliche Engagement und die Motivation der Lehrerinnen alleine, reicht dafür nicht mehr aus. Es fehlt schlechthin an Angeboten. Wir fordern deshalb die Mittel für Lehrerinnenfortbildung zu erhöhen, um das Angebot quantitativ und qualitativ zu verbessern. Dies ermöglicht nicht nur ausgebildeten Lehrerinnen ihreUnterrichtsqualität zu erhöhen, sondern auch Quereinsteiger*innen. Für diese fordern wir verpflichtende Fortbildungen vor allem in den Bereichen Pädagogik, Psychologie und Didaktik, sowie Begleitprogramme in den ersten Berufsjahren.
Das BAföG ist eine sozialdemokratische Errungenschaft, reicht aber aktuell längst nicht zum Leben aus. Immer weniger Menschen beziehen BAföG und das aus unterschiedlichsten Gründen. Die Rückzahlung und somit die Verschuldung nach dem Studium, die Regelstudienzeit, bürokratische Hürden und letztlich auch externe Belastungen wie Ehrenamt, Nebenjobs oder Pflegetätigkeiten sind nur einige davon. BAföG sollte den Anspruch haben, individuelle Bildungs-und Weiterbildungswege zu ermöglichen und muss deshalb von der Regelstudienzeit entkoppelt werden. Es braucht weiterhin eine regelmäßige Anpassung der Frei-und Förderbeträge und langfristig eine strukturelle Reform, um die Anpassung an die Lebensrealität der Studierenden auf den Weg zu bringen. BAföG muss außerdem unabhängig vom Einkommen der Eltern sowie bereits vor Studienbeginn gewährt werden, um ein wirklich selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen.
Wir lehnen Studien-bzw. sämtliche Bildungsgebühren aus sozial-, bildungs,-und gesellschaftspolitischen Gründen konsequent ab. Sie verstärken die soziale Selektivität und die Ökonomisierung im Bildungs-und Hochschulbereich und setzen somit bestehende soziale Ungleichheiten fort. Als Jungsozialist*innen ist es unser Anspruch, dass alle Menschen den gleichen Zugang zu Bildung haben und Bildung nicht von der sozialen Herkunft und dem Geldbeutel der Eltern abhängt. Entgegen einer Politik der schwarzenNull – auch im Hochschulbereich: Hinter dem Konzept der schwarzen Null steht ein neoliberales Gesellschaftsverständnis, nach dem ausschließlich Eigeninteressen im Fokus stehen und eine emanzipatorische, unabhängige Wissenschaft, fernab von Privatisierung nicht möglich ist. Hochschulen dürfen keine einzelnen Leuchttürme in der Bildungslandschaft sein, sondern auch immer Spiegel der Gesellschaft. Um die Autonomie der Hochschulen und somit die Forschungs-und Wissenschaftsfreiheit zu sichern, müssen Hochschulen grundfinanziert werden, damit Drittmitteleinwerbung nicht mehr nötig ist. Forschung und Lehre sollten eine Einheit bilden. Sie ergänzen und beeinflussen einander gegenseitig. Damit Forschung auf dem aktuellen Stand stattfinden kann, muss Studierenden schon während des Studiums die Möglichkeit gegeben werden, eigene Forschungsgruppen zu bilden und wissenschaftliches Arbeiten zu lernen.
Hochschulen sollten allen Menschen offenstehen, unabhängig von ihrer sozioökonomischen Herkunft und finanziellen Situation. Dazu müssen als erstes ausreichend Studienplätze geschaffen werden und gleichzeitig der Zugang zur Hochschule reformiert werden. Ob Wohnraum, Hochschulstruktur oder Studienfinanzierung – die Studierendenwerke sind die wichtigsten Anlaufstellen wenn es um soziale Fragen im Studium geht und müssen sowohl finanziell als auch infrastrukturell gestärkt werden. Soziale Hochschule bedeutet auch, dass Studierendenwerke nicht auf Semesterbeiträge angewiesen sind, sondern aus öffentlicher Hand finanziert werden. Hierbei muss insbesondere eine demokratische Ausgestaltung auch eine Rolle spielen, um die soziale Infrastruktur an Hochschulen von und für Studierende gestalten zu können. Hochschule muss feministisch sein. Noch immer liegt die Frauenquote unter den Professuren zwischen 20 und 30 Prozent und gläserne Decken sowie bestehende Männernetzwerke und intransparente Berufungsverfahren hindern vor allem Frauen daran, eine wissenschaftliche Karriere aufzunehmen. Auch Hochschulen sollten einen feministischen Ansatz verfolgen und frauenspezifische Förderprogramme sowie feste Zielquoten initiieren.
Demokratische Hochschule bedeutet auch, dass alle Mitglieder der Hochschule die gleichen Rechte auf Beteiligung an hochschulischen Entscheidungen erhalten. Die paritätische Besetzung aller Hochschulgremien ist die Voraussetzung für ein demokratisches Miteinander aller Statusgruppen. Hochschulen sollten Orte der Begegnung und des Dialoges sein. Im Vordergrund steht dabei die Befähigung zur kritischen Analyse und Weiterentwicklung gesellschaftlicher Lebens-und Arbeitsweisen. Kritische Wissenschaft muss durch die Autonomie der Hochschulen sichergestellt werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass Hochschulen Diskurse innerhalb der Gesellschaft anstoßen und mitgestalten.
Die Jusos erkennen den unbedingten Bedarf nach einer Wende im gesellschaftlichen und globalen Mobilitätsverhalten der Menschen. Wir setzen uns dafür ein, unsere Lebensqualität zu verbessern und eine gesunde Umwelt zu erhalten. Dafür werden wir die Mobilitätswende und die Forschung an Wasserstoffantrieben bei allen Verkehrsträgern gezielt vorantreiben. Als Verband, der sich dem nachhaltigen Denken verpflichtet hat, müssen wir die Mobilität, als essentielles Segment des menschlichen Zusammenlebens zukunfts-bzw. umweltorientiert und unseren Ansprüchen gerecht werdend, weiterentwickeln. Das gesamte Mobilitätsverhalten des Menschen und die vorherrschenden Denkweisen müssen sich dabei verändern und an globalen Nachhaltigkeitszielen sowie einer sozialen Ausgewogenheit ausrichten. Der Verkehrs-und Mobilitätssektor zählt zu den größten Verursachern von Umweltverschmutzung überhaupt: In Europa allein werden fast ein Viertel aller Emissionen generiert. Im Gegensatz zu nahezu allen anderen Sektoren konnte der umweltschädliche Ausstoß seit 1990 nicht reduziert werden und stieg zuletzt wieder an. Wenn die EU ihre eigenen Klimaziele bis 2050 erreichen will, muss es schnellstmöglich zu einem Umsteuern im Verkehrssektor kommen. Elektromobilität und andere alternative Antriebe und Brennstoffe bieten hierfür die besten Lösungsmöglichkeiten, daher müssen die notwendigen Rahmenbedingungen gesetzt werden – politisch, regulatorisch, technisch und wirtschaftlich. Die Umsetzung muss sowohl Straße, Schiene, Luft und Wasser betreffen. Gleichzeitig darf der soziale Aspekt beim Thema Mobilität nicht außer Acht gelassen werden. So müssen die Ziele und Maßnahmen sozial gerecht angegangen werden. Uns ist klar, dass Teilhabe an Mobilität für jeden möglich sein muss. Daher sind Schnellschüsse, die gravierende Änderungen von heute auf morgen herbeiführen wollen nicht in unserem Sinn. Mobilität darf nicht vom Geldbeutel abhängen, Privilegierte dürfen nicht in der Position sein, durch ihre Stellung in moralische Überlegenheit zu gelangen oder sich vom Klima-und Umweltschutz freikaufen zu können. Wir sehen deshalb gerade mit der Elektromobilität Chancen, die Mobilität sozialer, effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten – aber nur wenn alle Aspekte aufeinander abgestimmt zusammenwirken. ÖPNV statt MIV – in Stadt und Land: Wir brauchen eine komplette Umstrukturierung des Nahverkehrs. Der motorisierte Individualverkehr (MIV) muss langfristig durch einen gut ausgebauten ÖPNV abgelöst werden. Damit dies gelingen kann, ist der Ausbau einer tatsächlich flächendeckende Versorgung mit einer entsprechend hohen Taktung unerlässlich. Gleichzeitig muss der ÖPNV weitestgehend elektrifiziert werden. Unser Fernziel ist die autofreie Innenstadt. Dafür müssen Umweltqualitätszonen eingerichtet werden und es bedarf eines allgemeinen Umdenkens, das Prinzip „Nutzen statt Besitzen“ muss unser aller Handlungsmaxime werden. Der moderne ÖPNV muss E-Mobilität auf Straße und Schiene einbinden: E-Busse, Oberleitungsbusse, Straßenbahnen und S-Bahnen sollen die Menschen in der Stadt und auf dem Land von A nach B bringen. Um all diese Veränderungen zu realisieren, muss der ÖPNV ausfinanziert sein. Gleichzeitig müssen nahtlose Anschlussmöglichkeiten installiert werden, insbesondere Bike&Ride und Park&Ride. Dabei darf es auch nicht zur innerstädtischen Übervorteilung für E-Autos kommen – der ÖPNV hat Vorrang. Investitionen in einen nachhaltigen ÖPNV sind immer als Umverteilung zu begreifen. Zugang zu Mobilität muss für all möglich sein. Wir wollen kurzfristig eine Ausweitung von Sozialtickets (Azubi– , Schülerinnen– , Freiwilligendienstleistende-,Student*innentickets) unser Ziel bleibt dabei ein fahrscheinloser ÖPNV. Der Ausbau des ÖPNV in ländlichen Räumen ist kaum voran geschritten. Deshalb erkennen wir die Lebensrealität der Menschen, die in ländlichen Räumen leben, an und lehnen pauschale Verurteilungen und Verbote ab.
Notwendig ist auch eine Verlagerung großer Verkehrsanteile des Güter-und Personenverkehrs von der Straße auf die elektrifizierte Schiene. Das geht nicht ohne den Ausbau der Schieneninfrastruktur: Mehrspurigkeit der Strecken, mehr und größere Züge, moderne Güterbahnhöfe und Anbindungen an Industriegebiete, kleinere Städte und Ortschaften. Alle müssen sich Mobilität leisten können, auch auf der Schiene. Im Fernverkehr, braucht es deshalb ein Tarifsystem, dass allen die Nutzung ermöglicht, im Nahverkehr den fahrscheinlosen Zugang. Außerdem braucht es für eine echte ökologische Verkehrswende, die vollständige Elektrifizierung der Schiene., 100 Prozent des Schienennetzes muss mit Oberleitungen ausgestattet sein, aktuell sind es nur 60 Prozent. Um den gesamten Schienenverkehr auf elektrischen Betrieb umzustellen, muss der Dieselmotor auch auf der Schiene ein Auslaufmodell sein.
Wir brauchen massive Investitionen in den Ausbau und die Forschung für eine Weiterentwicklung der Luftfahrt. Die Elektromobilität sollte Einzug in den fliegenden Güter-und Personenverkehr erhalten. Dabei müssen innovative Ideen vorangetrieben und umgesetzt werden. Wir wollen eine europäische Kerosinsteuer und die Aussetzung der Luftverkehrssteuer für Elektro-bzw. Hybridflugzeuge. Außerdem ein koordiniertes europäisches und internationales Vorgehen bei Investitionsprogrammen.
Auch der globale Schiffsverkehr muss nachhaltig neu gedacht werden: kurzfristige Umrüstung und Modernisierung der Flotte, was insbesondere den Umstieg von Schweröl auf Diesel bedeutet. Langfristig braucht es allerdings Forschung zu nachhaltigeren Lösungen. Dabei sollten die Chancen der Elektromobilität und von Hybridantrieben genutzt werden. Ebenso muss die Binnenschifffahrt gestärkt werden, da diese im Güterverkehr ökologischer ist als LKW und die Straßen entlastet.
Wir halten eine kurzfristige deutliche Erhöhung des Marktanteils von Elektro-Autos für sinnvoll. Fernziel ist es, ohne konventionell betriebene Autos auskommen. Der Anteil des motorisierten Individualverkehrs sollte dabei reduziert werden. Die Produktion von Elektroautos und elektronischen Antrieben aller Verkehrsträger muss umweltfreundlich und sozialverträglich ausgestaltet sein, sowohl in den Abbauregionen der Rohstoffe, als auch während der industriellen Produktion aller benötigten Bestandteile. Der Energieverbrauch und CO2-Ausstoß bei der Produktion elektronischer Antriebstechniken muss gesenkt werden, um die umweltbezogenen Vorteile, die durch den Betrieb von Elektromotoren erzielt werden, nicht durch eine ökologisch und sozial nachteilige Herstellungsweise wieder zu reduzieren. Wir sprechen uns gegen eine einseitige Fokussierung auf batteriegestützten E-Mobilität und für verstärkte Investitionen in den Bereich der Brennstoffzellen-Technologie und Infrastruktur aus.
Internationale Organisationen zu Räumen dialogbasierter Konfliktlösung und verbindlicher Entscheidungen machen: Auch die Herausforderungen der heutigen Zeit können nicht im nationalen Gegeneinander bewältigt werden. Die aktuellen Drohgebärden unter den Großmächten, sowie eine undurchsichtige internationale Strategie seitens einiger unsere Bündnispartner*innen zeigen besonders deutlich, wie bilateraler Egoismus zur Bedrohung für die Weltgemeinschaft wird. Es braucht eine linke Initiative, die sich der Hürden in den internationalen Organisationen annimmt, um sie wieder zu den Schauplätzen der internationalen und demokratischen Auseinandersetzung zu machen. Mit YES und IUSY bringen wir uns bereits konkret in internationale Organisationen ein, wie beispielsweise über IUSY in der am UN-Wirtschafts-und Sozialausschuss (ECOSOC) angegliederten United Nations Major Group for Children and Youth (UNMGCY). Wir müssen die Dominanz europäischer und eurozentristischer Denk-und Vorgehensweisen aufdecken, benennen und beseitigen. Internationale Organisationen und Institutionen müssen die verschiedenen historischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge in den verschiedenen Regionen der Welt berücksichtigen. Noch immer sind Kolonialismus, die Sklaverei, Missionierung und die zahlreichen Verbrechen der Kolonialmächte nicht hinreichend aufgearbeitet und entschädigt worden. Wer aus Westeuropa heraus für eine feministische, demokratische und sozialistische Welt kämpft, muss sich seiner eigenen Privilegien bewusstwerden und die Rolle eines stärkenden, solidarischen Verbündeten im Kampf gegen Armut, Entrechtung und Unterdrückung einnehmen.
Aus den aktuellen Schwächen der internationalen Organisationen folgt jedoch auch dass unsere dortige Arbeit nicht das einzige Standbein bleiben kann. Die politischen Orte zur Lösung internationaler Herausforderungen wiederzubeleben, muss zum europäischen Projekt werden. Eurozentristische Perspektiven lehnen wir dabei entschieden ab – wir möchten gemeinsam mit Menschen aus aller Welt die internationalen Herausforderungen dieses Jahrhunderts lösen und die gut ausgebauten europäischen Strukturen dafür nutzen und zur Verfügung stellen. Darüber hinaus gilt es, weitere progressive internationale Bündnispartner*innen in den Blick zu nehmen und die Kooperation zu traditionell und neu hervorgegangenen progressiven Regierungen auszubauen.
Die dahinterstehenden progressiven Parteien dieser Welt müssen es sich zur gemeinsamen Aufgabe machen, internationale Räume zu schaffen, in denen verbindliche Entscheidungen getroffen werden. Das Einstimmigkeitsprinzip ist hiermit nur in Ausnahmesituationen, wie etwa militärischen Interventionen, tragfähig.
Es wird nicht einfach werden, einen Ausgleich zwischen der Eindämmung transatlantisch zentrierter Perspektiven und dem Bedürfnis großer Volksökonomien nach entsprechender Einflussnahme zu finden. Die aktuellen internationalen Organisationen scheitern an diesem Spannungsfeld und sind nicht in der Lage effektive und bindende internationale Entscheidungen zu treffen, die über eine normgebende Funktion hinaus wirken. Stattdessen haben sie sich in wahllosen Substrukturen untergliedert und Mechanismen des Soft Laws verloren, die nicht rechtlich schützen, sondern faktisch Zwang ausüben. Auf diese Weise wird die Forderung nach Demokratie mit der marktwirtschaftlichen Ordnung der internationalen und nationalen Produktion gleichgesetzt. Dass die Gründung internationaler Organisationen mit der Diffusion des Kapitalismus zusammenfällt, ist keine Zufälligkeit. Sie bestätigt vielmehr, dass die Organisation der Produktion und die Versorgung der Menschheit der Ausgangspunkt ihrer Politik ist. Genau diese Fragen der Verteilung und Versorgung müssen international verbindlich diskutiert werden können. Unsere Parteienfamilie muss diese Erkenntnis nutzen, um mit neuen Positionen zu der Frage der tatsächlichen, fairen Verteilung von Wohlstand international in Erscheinung zu treten und hierzu Verbindlichkeit zu erreichen.
Nicht die Augen verschließen vor den autoritären Regimen dieser Welt: Wir können dabei jedoch auch nicht die Augen verschließen vor solchen Regimen, denen freiheitliche Demokratien ein Dorn im Auge sind, die Einschränkung und Verwehrung von Grundrechten für Frauen und LGBTIQ mit kulturellen und religiösen Hintergründen zu begründen versuchen und die den militärischen Konflikt mit der Weltgemeinschaft als Drohgebärde nutzen, wie etwa in Saudi Arabien, Nordkorea oder im Iran. Europas historische Aufgabe ist hier, für Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie auf der ganzen Welt einzutreten – dies kann nur in einer Vermittler-und Unterstützer*innen-Rolle geschehen. Jedem Regime, dass Menschenrechte missachtet, steht eine Zivilgesellschaft entgegen.
Doch diese ist in der Regel nicht einheitlich und umfasst -häufig im Untergrund-auch progressive Bewegungen, die häufig Repression erfahren. In inter-und multinationalen Abkommen, insbesondere Anti-Waffen-Abkommen und Anti-Atomabkommen, gilt es Ergebnisse zu erzielen, die progressive Bewegungen unterstützen und sich gleichzeitig kompromisslos in grundrechtlichen Fragen zeigen. Ziel dieser Abkommen muss die internationale Demilitarisierung sein.
In der Frage militärischer Auseinandersetzung sehen wir die Bundesrepublik und ihre Streitkräfte vor dem Hintergrund der historischen Realität der von Deutschland verursachten Weltkriege und der Shoa in einer besonderen Verantwortung. Eine souveräne Bundeswehr kann vor diesem Hintergrund kein von uns angestrebtes Ziel sein. Sie muss in einer Europäischen Armee aufgehen, in der sich die Bundesrepublik einer erweiterten Staatengemeinschaft gegenübersteht. Dabei stehen wir weiterhin zum Prinzip der Parlamentsarmee, auch auf europäischer Ebene. Nationalistische und Faschistoide Tendenzen müssen in einer möglichen europäischen Armee vom ersten Tag an bekämpft werden, um Verhältnisse wie in der heutigen Bundeswehr von vorne herein zu verhindern.
Gewalt und militärische Mittel sind für uns die Ultima Ratio. Aber obwohl wir versuchen, jedem Konflikt zuallererst friedlich zu begegnen, müssen wir die Existenz von Situationen anerkennen, in denen zivile Mittel der Krisenbewältigung an ihre Grenzen stoßen. Verbrechen gegen die Menschheit können Situationen sein, in denen diese letzte Möglichkeit in Betracht gezogen werden muss. Ein militärischer Einsatz kann jedoch nie der Ersatz für politische Konzepte zur Lösung von Konflikten sein. Er muss immer kritisch begleitet werden. Eine aktive Sicherheits-und Außenpolitik schließt also den Einsatz von Streitkräften nicht grundsätzlich aus. Wir wollen den Einsatz militärischer Mittel weder herbeisehnen, noch ihn im Ernstfall, sofern er zur Abwendung von Verbrechen gegen die Menschheit notwendig ist, kategorisch ablehnen. Das Konzept der „Responsibility to Protect“, welches durch die Vereinten Nationen erarbeitet wurde, sehen wir durch seine Vielschichtigkeit geeignet, ein Grundpfeiler friedenssichernder Außenpolitik zu werden. Es ist in unseren Augen richtig, Staaten zuallererst selbst für ihre Stabilität sorgen zu lassen, und erst im zweiten Schritt die internationale Gemeinschaft zur Akteurin zu machen. Die drei Pfeiler • Responsibility to Prevent • Responsibility to React und • Responsibility to Rebuild
bilden eine verbindliche Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit Interventionen jeglicher Art. Wir bekennen uns dabei zu einer zivilen Ausformulierung der Bereiche Prävention und Wiederaufbau. Die weitere Militarisierung in Vergangenheit und Zukunft lehnen wir daher ab. Wirksame Prävention und nachhaltiger Wiederaufbau können nur unter ziviler Federführung und enger Einbeziehung der handelnden Akteur*innen vor Ort funktionieren.
Das Konstrukt des Nationalstaates kann zudem erst dann in den Hintergrund treten, wenn es internationale Dynamiken als Regulator abgelöst haben. Interessant ist, dass dies für den Verlauf globalisierter Wirtschaftsströme im großen Umfang bereits der Fall ist. Zur Internationalisierung der Weltgesellschaft muss es unser Anliegen sein die Mitglieder dieser auf die Verbundenheit all unser Anliegen hinzuweisen, ihre Belange in Kontext zu setzen und die vielen regional begrenzten Proteste zusammenzuführen. Unser Verständnis von internationaler Solidarität ist mit dem politischen Ziel der befreiten internationalen Gesellschaft verknüpft. Überall auf der Welt organisieren sich Menschen, riskieren ihr Leben und bilden eine neue Form politischer Protestkultur. Auch dieser internationalen Linken erklären wir uns im Sinne der Doppelstrategie zugehörig. Auf diese Weise ist der Internationalismus nicht bloß theoretisches Lippenbekenntnis sondern gelebte Solidarität und zukunftsgerichtete Mehrheitsbildung. Unsere Solidarität gilt den Sozialist*innen aller Länder -mit ihnen wollen wir eine Mehrheit bilden. Hoch die internationale Solidarität!
Das Patriarchat unterdrückt Menschen auf der ganzen Erde – Zeit, es zu zerschlagen! Dabei befinden sich Feministinnen in unterschiedlichen Regionen der Welt in verschiedenen Ausgangssituationen wieder, die wir berücksichtigen müssen, wenngleich der Kampf gegen das Erstarken der Nationalismen und des organisierten Sexismus uns alle eint. Universell gilt jedoch, dass wir Europäerinnen anstelle der aktuellen „Entwicklungspolitik“ dort strukturell und finanziell unterstützen müssen, wo Frauen, Nicht-Binäre, Inter-und Transmenschen auf der ganzen Welt ihre Befreiungskämpfe führen. Besonders müssen wir dabei die Situation von nicht-männlichen Menschen im Zuge von UN-Einsätzen, in kriegerischen Auseinandersetzungen und auf der Flucht berücksichtigen. Hier gilt es, den Zugang zu Bildung, Versorgung und zu wirtschaftlichen Wohlstand für alle Menschen zu ermöglichen. Progressive und sozialistische Frauenbewegungen und LGBTIQ-Bewegungen sind für uns natürliche Bündnispartnerinnen, mit denen wir solidarisch sind. Feminismus ist in der immer noch stereotyp männlich dominierten Diplomatinnen-Welt nicht nur Querschnittsthema, sondern eine eigene Säule unserer internationalen Arbeit.
Unsere Vision: Die vereinigten Staaten von Europa Die EU stellt einen einzigartigen Versuch dar, einen Kontinent politisch zu einen. Dennoch fehlen ihr aufgrund ihrer Konstruktion und ihrer ursprünglichen Intention wirtschaftlicher Zusammenarbeit zur Abrüstung sowie Bildung eines mächtigen zentraleuropäischen Wirtschaftskonglomerats – eine konsequent demokratische Struktur und Kultur sowie eine soziale und ökologische Grundausrichtung. Um dem entgegenzuwirken, braucht es eine grundsätzliche Veränderung der europäischen Verträge. Unsere Europäische Union ist ein föderal organisierter, souveräner Staat. Sie ist eine parlamentarische Demokratie mit einem zwei-Kammer-System, in dem eine direkt gewählte erste Kammer mit Initiativrecht und Budgethoheit (Vollparlament) einer regional organisierten zweiten Kammer gegenübergestellt ist. Die Exekutive wird ausschließlich vom Parlament bestimmt. Im selben Zuge muss die Europäische Judikative gestärkt und der Europäische Gerichtshof zu einem Verfassungsgericht ausgebaut werden. Einer vollwertigen Exekutive und Legislative ist eine starke und funktionierende Judikative entgegenzustellen, deren Aufgabe insbesondere der Schutz von Demokratie, Föderalismus, Sozialstaat, Rechtsstaat und antifaschistischem Selbstverständnis ist. Die Aufgabenverteilung erfolgt nach dem Prinzip der Subsidiarität. Hinter der Auseinandersetzung um das Subsidiaritätsprinzip verbirgt sich derzeit allzu oft ein Abwehrkampf gegen eine vertiefte Integration und Vergemeinschaftung weiterer Politikfelder. In einem Gemeinwesen wie dem europäischen kann und darf es weder zu einer Machtkonzentration auf ein Zentrum kommen, noch darf es zu einem kompletten Hinabrollen der Kompetenzen auf die einzelnen Mitgliedstaaten und/oder ihrer Untergliederungen kommen. Wir stehen für ein Europa der Selbst-und Mitbestimmung seiner Menschen. Jede Ebene der Demokratie und Verwaltung muss die Aufgaben übernehmen, in der sie die meiste Kompetenz aufweist.
Die EU als Fortschrittsprojekt muss sich gegen reaktionäre Tendenzen zur Wehr setzen und das Instrument der Sanktionsmechanismen ausweiten, um Staaten, die das Rechtsstaatsprinzip oder Menschenrechte außer Kraft setzen wollen und Rassistinnen und Nationalistinnen hofieren, in die Schranken zu weisen. Die europäische Sozialdemokratie muss hier Wege finden progressiven Ideen Räume zu schaffen, die dazu führen das Gruppierungen des linken Spektrums nicht mehr „nur“ auf der Straße sondern auch wieder im Parlament vertreten sind und ein Gegengewicht zu rechten Kräften aufbauen können. Die EU muss Instrumente schaffen, die Raum für zivilgesellschaftliches Engagement garantieren und diesen vor Angriffen von rechts durch Mitgliedsstaaten beschützen.
Die tiefe soziale und wirtschaftliche Spaltung der EU kann nicht durch ein paar Reparaturen behoben werden. Was es vielmehr braucht, ist eine grundsätzliche Umkehr in der europäischen Wirtschaftspolitik – vom neoliberalen Glauben an den Markt hin zu einer an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichteten Wirtschaftsordnung, die wirtschaftliche Ungleichheiten in Europa aktiv bekämpft. Sozialer Ungleichheit stellen wir das Prinzip der Sozialstaatlichkeit im Rahmen eines sozialen Europas entgegen. Die wichtigste Aufgabe des Sozialstaates ist, allen Menschen in Europa ein menschenwürdiges und existenzsicherndes Leben zu ermöglichen. Das bedeutet auch eine Abkehr von jeglicher Austeritäts-, und Sparpolitik der vergangenen Jahre. Organisationsformen wie die Troika darf es nicht noch einmal geben. Unser Europa stärkt die Rechte von Arbeitnehmernnen. Es setzt verbindliche Sozialstandards durch und kämpft entschlossen gegen Sozialdumping. Wir wollen ein Europa der starken Gewerkschaften und der Tarifpartnerschaft. Wir stehen für ein europäisches Streikrecht und betriebliche Mitbestimmung in allen Mitgliedstaaten ein. Es investiert in die Zukunft und schafft gleiche Lebensbedingungen. Mit einer gemeinsamen Wirtschafts-und Finanzpolitik, die auf Zukunftsinvestitionen statt auf Haushaltskontrolle fußt, wollen wir sozialen Fortschritt und Prävention vor weiteren Krisen schaffen. Der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit stellt in unserem Europa eine der wichtigsten Herausforderungen dar, weshalb die ungleiche Verteilung von Vermögen infolge von Lohndumping und unharmonischer Unternehmensbesteuerung einerseits und einer zu geringen Investitionstätigkeit von Seiten der Staaten sowie der Unternehmen andererseits angegangen werden muss. Entsprechend wollen wir mit der Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung gleiche Wettbewerbsbedingungen in den Einzelstaaten schaffen. Der Bruch mit dem Dogma des sparsamen Staates und die Rückkehr zu antizyklischer Haushaltspolitik korrigiert zudem wirtschaftspolitische Verfehlungen der letzten Dekade. Durch Umverteilung von Vermögen von der Unternehmensseite hin zur Haushaltsseite wollen wir zudem den Binnenkonsum stärken und damit Arbeitsplätze schaffen. Die Natur kennt keine Grenzen-sozial-ökologischer Wandel setzt mehr internationale Zusammenarbeit voraus: Für uns stehen soziale und ökologische Missstände in einem starken Zusammenhang. Denn in der Bekämpfung von Beidem – der wachsenden sozialen Ungleichheit und der ökologischen Selbstgefährdung der Gesellschaft – sehen wir die zentralen politischen Herausforderungen unserer Zeit. Fortschritt – als eine Verbesserung dieser Missstände – kann es für uns nur geben, wenn Wachstum immer gleichzeitig sozialen und ökologischen Zielen dient. Gleichzeitig müssen wir konstatieren, dass nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung vom, auf Kosten der Umwelt und zu Lasten großer Teile der Bevölkerung, produzierten Reichtum profitiert. Dieser Teil der Weltbevölkerung lebt vornehmlich in den westlichen Industrienationen, welche für den Großteil des globalen Ressourcenverbrauchs und der globalen Umweltbelastungen verantwortlich sind. Europa steht hier in der Verantwortung auf das Einhalten der Ziele des Pariser Klimaabkommens zu drängen und die CO2 Reduktion massiv voranzutreiben durch Maßnahmen in den Bereichen Mobilität, Energie, Bauen, Landwirtschaft und Industrie. Dabei dürfen die Regionen, die im Zuge der Transformationsprozesse seit den 1990er Jahren bereits unter hoher Arbeitslosigkeit, einem starken Niedriglohnsektor und einer kaum vorhandenen öffentlichen Infrastruktur leiden, nicht noch weiter belastet werden. Für uns ist klar: international Agierende Konzerne tragen die Hauptverantwortung für den CO2-Ausstoß, daher muss es die Europäische Union sein, die reguliert und sanktioniert. Dabei muss auch bedacht werden, dass ein immer größerer Teil der umweltschädlichen und menschenverachtenden Geschäftstätigkeiten auf Grundlage von Freihandelsabkommen mit Ländern des Globalen Südens stattfinden kann. Wir fordern daher eine wertgebundene Handelspolitik auf Augenhöhe ein, in der die Prinzipien der Sustainable Development Goals, insbesondere die Wahrung von Menschenrechten, Arbeiterinnen-Rechten und Umweltschutzstandards, kompromisslos eingehalten werden. Dafür ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, stärker mit unseren demokratisch-sozialistischen und progressiven Partnerinnen vor Ort in Kontakt zu treten, um deren Forderungen und Bedürfnisse mehr politisches Gewicht zu geben. Gemeinsame Sicherheits-und Verteidigungspolitik forcieren, damit Europa sich als echte Friedensmacht etabliert: Die globalen Krisen und Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit stellen die europäische wie deutsche Außenpolitik vor enorme Herausforderungen: Bemühungen, das globale Miteinander durch multilaterale Absprachen und vor dem Hintergrund demokratischer Prinzipien zu gestalten, stoßen auf zahlreiche Widerstände und vermehrt auf nationale Egoismen, die Demokratie, Menschenrechte und Frieden gefährden. Die russische Eskalationsdominanz, die jüngst in der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim mündete, markiert eine deutliche Zäsur. Auch die neuen Töne aus Washington sind eine Herausforderung. Gewissheiten, die den politisch Handelnden in Europa und der Bundesrepublik in den Jahrzehnten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Orientierung und Richtung gegeben haben, verlieren an Kraft. Die Europäische Union muss angesichts dessen ihre politische und strategische Rolle auf internationalem Parkett neu definieren, ohne dabei aus den Augen zu verlieren, dass in einigen ihrer Mitgliedsstaaten ebenfalls Kräfte erstarken, die sich eine Rückkehr zum Nationalstaat und dem Leitbild der illiberalen Demokratie verschrieben haben. Vor allem die Absage der USA an ihre tradierte Rolle als ordnungspolitische Großmacht, die sich der Verteidigung der liberalen Demokratie und der Wahrung von Menschenrechten verschreibt, erfordert von der EU, dass sie mehr Verantwortung übernimmt und sich parteiisch auf die Seite universell geltender Rechte stellt. Angesichts der vielfältigen globalen Herausforderungen müssen wir die EU zudem in die Lage versetzen, gegenüber ihren internationalen Partnerinnen mit einer Stimme sprechen zu können. Europas wirtschaftlicher Profit darf nicht auf dem Rücken der Menschenrechte erwirtschaftet werden. Das übergeordnete Ziel muss sein, auf eine weltweite koordinierte Abrüstungspolitik hinzuwirken und dabei auf europäischer Ebene mit gutem Beispiel voran zu gehen. Wir sehen es daher als zwingend an, dass mit der schrittweisen Umwandlung der nationalstaatlichen Streitkräfte in eine europäische Friedenstruppe im Rahmen einer europäischen Sicherheits-und Verteidigungspolitik parallel eine Umstrukturierung der Rüstungsindustrie wie auch der -exportpraxis durchgeführt wird. Für eine Friedensmacht, die Europa sein möchte, sind Rüstungsexporte in aller Regel moralisch nicht vertretbar. Die Produktion von Rüstungsgütern und Waffen muss zudem in die öffentliche Hand und darf nicht länger der Privatwirtschaft überlassen werden.
Internationaler Handel: Wir befürworten internationalen Handel. Insbesondere zwischen vergleichbar starken Partnerinnen, bietet er die Möglichkeit zum gegenseitigen Wohlstandsgewinn und kann zu Frieden, einem besserem Verständnis füreinander und Annäherung führen. Zölle lehnen wir grundsätzlich als Mittel zur staatlichen Einnahmengenerierung oder zur einseitigen Förderung einer merkantilistischen Agenda ab. Freier Handel ist für uns jedoch kein Selbstzweck. Handelspolitik ist für uns auch Gestaltungsinstrument für internationale Beziehungen und kann aus Gründen des Umwelt-oder Verbraucherinnenschutzes, sowie übergeordneten sozialen und ökonomischen Zielen eingeschränkt werden. Ausbeuterische Handelspolitik mit Ländern des globalen Südens beenden: Insbesondere im Bereich des Exports von Agrarprodukten schaden stark subventionierte europäische Produkte Entwicklungsländern vor allem auf dem afrikanischen Kontinent. Wir lehnen eine verzerrende Subventionierung von für den Export bestimmten Produkten ab. Die vielen ökonomisch schwächeren Ländern durch Handels-und Investitionsabkommen aufgezwungene Freihandelspolitik belässt diese Länder in ökonomischer Abhängigkeit zu entwickelten Industriestaaten und hemmt sie in ihrer Entwicklung. In der Vergangenheit haben Deutschland und die EU eine Vielzahl von Abkommen mit AKP-Staaten (Afrika-Karibik-Pazifik) abgeschlossen, die einseitig eigene Kapitalinteressen verfolgen. Wir fordern die Aufkündigung dieser asymmetrischen Abkommen. Insbesondere vor dem Hintergrund der jahrhundertelangen Kolonialisierung ist es für viele der betroffenen Staaten nicht sinnvoll an einem gemeinsamen und unregulierten Markt mit westlichen Industriestaaten teilzunehmen. Ihnen muss die Gelegenheit gegeben mit Schutzzöllen die heimischen Wirtschaftsstrukturen zu schützen und aufzubauen. Wir fordern daher, dass die EU Handelsverträge erst abschließt, wenn die potentiellen Vertragspartnerinnen, die UN-Menschenrechtscharta und die ILO-Kernarbeitsnormen ratifiziert und wirksam implementiert haben.
Die westliche Welt muss sich ihrer Verantwortung mit Blick auf die Geschichte von Kolonialismus, Sklaverei und Menschenhandel bewusstwerden. Wir lehnen daher den gängigen Entwicklungsbegriff ab und setzen auf internationale Zusammenarbeit und Solidarität auf Augenhöhe. Wir möchten gemeinsame Wege finden, Menschenrechte, Frieden und Wohlstand zu einem weltweiten Standard zu machen. Diese werden nicht explizit an der westeuropäischen Geschichte oder Weltvorstellung ausgerichtet, sondern an universellen Werten. Dabei möchten wir eng mit unseren Schwesterorganisationen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Zölle nein, aber: Der EU muss es möglich sein, in bestimmten Märkten Zölle oder nichttarifäre Handelshemmnisse zur Durchsetzung von Menschenrechten, arbeitsrechtlicher Mindeststandards (bspw. ILO-Kernarbeitsnormen), Zielen der Geschlechtergerechtigkeit, ökologischer Standards und zum Schutz vor Dumpingpreisen zu erlassen. Dabei dürfen keine höheren Anforderungen an importierende Länder gestellt werden als heimischen Unternehmen auferlegt werden. Einfuhrverbote dürfen bei besonders schwerwiegenden Verstößen oder aus Verbraucherschutzgründen ebenfalls ergehen. In besonderen Ausnahmefällen dürfen auch zeitlich begrenzt Zölle als ultima ratio zum Schutz heimischer Arbeitsmärkte erlassen werden oder zur Regulierung dysfunktionaler internationaler Märkte. Wir fordern daher, dass die EU die Einfuhr von Produkten in allen Branchen, bei denen die Einhaltung von Menschen-und Arbeitsrechten über die gesamte Wertschöpfungskette und mit allen Vor-und Zwischenschritten nicht von den Unternehmen nachgewiesen werden kann, verbietet. Die staatliche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) auf nationaler und EU-Ebene muss es sich zur Aufgabe machen, betroffene Länder und Unternehmen zur schnellen Umsetzung und Überwachung der Einhaltung von Menschen-und Arbeitnehmer*innenrechten zu beraten und zu unterstützen.
Die Erfahrungen mit Handelsboykotten als Instrument der Außenpolitik sind gemischt. Sie dürfen -insbesondere beim Boykott lebenswichtiger Güter - für uns nur äußerstes Mittel sein, das bei massiven Menschenrechtsverstößen zur Anwendung kommt und bedürfen der regelmäßigen zeitlichen Überprüfung. Grundsätzlich glauben wir, dass internationale Boykotte Annäherung eher erschweren und ziehen zielgenauere Maßnahmen, die bestimmte Gruppen, statt pauschal ganze Länder treffen, umfassenden Boykotten vor.
Von Handels-und Investitionsabkommen jeglicher Art müssen Bereiche der Daseinsvorsorge oder bestimmte Märkte mit hoher kultureller Bedeutung ausgenommen sein. Wir betrachten diese Bereiche als besonders sensibel und der staatlichen Regulierung in herausgehobener Weise unterliegend. Hier ist freier und internationaler Wettbewerb tendenziell schädlich und greift in grundsätzliche, demokratische Selbstbestimmungsrechte der Demokratien ein. Ebenso müssen andere Leistungen, die in den Ländern von staatlicher Seite erbracht werden, ausgenommen sein.
Wir lehnen die Einführung von Schiedsgerichten in den häufig Handelsabkommen flankierenden Investitionsschutzabkommen ab. Internationale Handels-und Investitionsstreitigkeiten sollen vor einer neu zu schaffenden, supranationalen Gerichtsbarkeit geklärt werden, die bspw. bei den Vereinten Nationen anzusiedeln ist und Streitigkeiten dieser Art in transparenten und öffentlichen Prozessen auf Basis demokratisch gesetzter Normen zu entscheiden hat.
Grundsätzlich bekennen wir uns zu einer Handelspolitik, die auf multilaterale Verständigung statt auf unilaterale Machtpolitik setzt. Die WTO hat sich in der Vergangenheit teilweise als dysfunktional, teilweise als einseitiges Instrument zur Durchsetzung der Interessen der entwickelten Industriestaaten erwiesen. Wir fordern deshalb ihre Auflösung und eine Übertragung der Aufgaben entsprechend der oben aufgeführten Prinzipien auf eine bei den Vereinten Nationen anzusiedelnde Agentur für Handelsfragen. An den Entscheidungen sollen auch internationale Gewerkschaftsverbände beteiligt werden. Dabei müssen die Länder, die in der Vergangenheit stark durch die Industrie-und Handelspolitik der westlichen Welt benachteiligt wurden oder unter Spätfolgen des Kolonialismus leiden, ein größerer Einfluss eingeräumt werden.
Wir wollen internationale Solidarität praktisch leben. Das Willy Brandt Center in Jerusalem ist für uns nicht nur ein Ort, an dem wir Begegnung, Austausch und Verständigung gemeinsam mit unseren Partnerinnen im Nahen Osten gestalten und seit über zwanzig Jahren praktizieren, auch im Konkreten jungsozialistischen Internationalismus auch im Konkreten greifbar machen. Aus dem Wissen um die historische Verantwortung Deutschlands, die Schuld der Shoah und das Schutzbedürfnis jüdischen Lebens stehen wir solidarisch an der Seite des Staates Israels und das Existenzrecht dieses Schutzraums ist für uns nicht verhandelbar. Ein solidarisches Band verbindet uns aber auch mit den progressiven Kräften der palästinensischen Gesellschaft. Avoda Youth Israel, Meretz Youth Israel und die Shabibeh Fatah begreifen wir als unsere engen Partnerinnen. Dabei reflektieren wir die Zusammenarbeit mit unseren Partnerinnen in regelmäßigen Abständen kritisch. Doppelte Solidarität, gegenseitige Anerkennung und die Schaffung einer umfassenden Friedensordnung im Sinne einer Zwei-Staaten-Lösung sind dabei die Leitplanken unseres Engagements. Die Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Solidarität bringen junge Menschen in diesem Projekt zusammen, um im begrenzten Rahmen unseres Projektes an einem Beitrag für eine friedenspolitische Lösung des Nahostkonfliktes zu arbeiten. Gerade in sich veränderten und weiter wandelnden internationalen politischen Rahmenbedingungen hat sich das Willy Brandt Center als Teil unserer internationalistischen Arbeit etabliert. Unser jungsozialistisches Verständnis von Politik ist immer international und das WBC bietet auch weiterhin in unserem Verband Anknüpfungspunkte, um über die konkrete Verständigung vor Ort hinaus wirken zu können. Feministische Friedensarbeit ist dabei ein großer Bestandteil, der in den letzten Jahren große Erfolge gezeigt hat. Internationalistische, feministische Arbeit kann über Staatsgrenzen hinaus bisherige gesellschaftliche Ordnungen, denen wir ablehnend gegenüberstehen, nachhaltig in Frage stellen. Feministische Bewegungen waren ebenso immer international ausgerichtet. Gerade Solidarität unter Frauen bietet die Möglichkeit ein anhaltendes, solidarisches Miteinander in Nahost und darüber hinaus zu etablieren.
Das kritisch-solidarische Verhältnis zur Mutterpartei prägt die Jusos seit ihrer Linkswende vor 50 Jahren. In dieser Tradition ist es unsere Aufgabe die Mutterpartei solidarisch bei der Erlangung von gesellschaftlichen Mehrheiten für sozialdemokratische Grundüberzeugungen zu unterstützen. Gleichzeitig wollen wir die Politik und die Ausrichtung der SPD im jungsozialistischen Sinne verändern und sowohl intern, wenn nötig aber auch in der Öffentlichkeit, konstruktive Kritik an Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen äußern, um der Partei einen Weg hin zu sozialistischer Politik aufzuzeigen.
In den letzten Jahren haben wir als Jusos einige inhaltliche Erfolge in der Programmatik der SPD erringen können. Neben den inhaltlichen Kämpfen um eine progressivere Ausrichtung der SPD muss es darüber hinaus aber auch ein Mittel der Wahl sein, linke Kräfte aus unserem Verband in Verantwortung innerhalb der SPD zu bringen. Deswegen müssen wir Personen mit linken Positionen, welche die Inhalte der Jusos vertreten, in der Partei sichtbarer machen und flächendeckend dafür vorbereiten innerhalb der SPD Führungspositionen einzunehmen. Wir wollen einen verbindlichen Juso-Platz in den geschäftsführenden Vorständen der SPD. Dieser ist auf Vorschlag der jeweils zuständigen Juso-Gliederung zu wählen. Zugleich muss gewährleistet werden, dass junge Menschen durch die Aufstellung auf guten Listenplätzen oder in aussichtsreichen Wahlkreisen tatsächlich in die Lage versetzt werden, in die Parlamente bis hin zum Deutschen Bundestag und zum Europäischen Parlament einzuziehen. Eine Juso-Quote kann hierfür eine angemessene Lösung sein. Die inhaltlichen Kehrtwenden vergangener Juso-Generationen geben uns hierbei Anlass, Funktionsweisen von Sozialisationsprozessen innerhalb von Führungsgremien und Fraktionen kritisch zu beleuchten. Wir müssen verhindern, dass diese Prozesse dazu führen, dass Jungsozialistinnen nach ihrer aktiven Juso-Zeit die inhaltliche sozialistische Grundausrichtung abhanden kommt. Außerparlamentarisches Standbein der Jusos stärken: Wir Jusos sind innerhalb der gesellschaftlichen Linken einer der wichtigsten Akteurinnen in der Bundesrepublik und beschränken unser Engagement nicht auf die Arbeit innerhalb der Sozialdemokratie, sondern wollen im Rahmen der Doppelstrategie auch Teil gesellschaftlicher Bewegungen sein und in diese hineinwirken. In breiten gesellschaftlichen Bündnissen kämpfen wir seit unserer Gründung vor über 100 Jahren für unsere Ziele an der Seite vieler zivilgesellschaftlicher Organisationen. Dabei haben wir in den letzten Jahren insbesondere die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaftsjugenden ausbauen können. Dieses Engagement müssen wir aber dringend ausbauen. Wir wollen im Hinblick auf zivilgesellschaftliche Bewegungen und deren Forderungen den Transmissionsriemen zwischen sozialen Bewegungen, Beschäftigten und ihren Arbeitskämpfen sowie den politischen Parteien bilden. Dafür ist es wichtig, dass wir an gesellschaftlichen Bewegungen teilhaben, uns in ihre Kämpfe einbringen und ihre Forderungen aufgreifen. Insbesondere in neuen sozialen Bewegungen wie etwa Fridays for Future oder Unteilbar müssen wir als politischer Jugendverband in der Bundesrepublik noch viel stärker vertreten sein und insgesamt unser umweltpolitisches und antifaschistisches Profil sichtbarer machen. In außerparlamentarischen Bewegungen, bei denen antisemitische Tendenzen vorzufinden sind, versuchen wir die Akteurinnen, die ein solches Gedankengut in die Bewegung tragen, herauszudrängen und positionieren uns klar dagegen. Wie wir mit solchen Situationen konkret umgehen, entscheiden wir bei jeder Bewegung individuell.
Wir Jusos sind Feministinnen. Die tatsächliche Gleichstellung ist unser Ziel. Wir leben im Kapitalismus und wir leben im Patriarchat. Wir streiten für den Systemwechsel und wir streiten für die Überwindung des Patriarchats. Dabei geht es in erster Linie um einen politischen Kampf der für uns keine geringere Priorität hat. Gleichzeitig ist uns diese Überzeugung Auftrag für die Arbeit in den eigenen Strukturen. Unsere Mitgliedschaft ist mehrheitlich männlich, diesen Zustand wollen wir ändern. Gelebter Feminismus bedeutet für uns deshalb mehr Frauen für das Engagement bei uns empowern und unsere Strukturen im Hinblick auf die Gewährung gleicher Beteiligungsmöglichkeiten und ihre die Zugänglichkeit zu hinterfragen. Auch die Repräsentation ist dafür zentral. Sowohl in der Mutterpartei als auch in unserem Verband müssen Frauen* und ihre Engagement in Diskussionen, auf Podien und in der Öffentlichkeitsarbeit sichtbar sein. Darüber hinaus wollen wir uns in der feministischen Bewegung einbringen und einen größeren Beitrag dazu leisten diese Kämpfe in die Partei erfolgreich einzubringen.
Sozialdemokratie als Führungskraft der gesellschaftlichen Linken positionieren: Die SPD muss ihren Anspruch die politische Linke in der Bundesrepublik anzuführen wieder neu stellen. Dies gelingt nur, wenn sie eine neue Offenheit gegenüber den wesentlichen Akteur*innen der gesellschaftlichen Linken ausstrahlt und auch bereit ist neue linke Debatten darüber zu eröffnen, wie Alternativen zum aktuellen Wirtschaftssystem aussehen könnten. Teil davon muss es aber auch sein, in sozialen Bewegungen wieder stärker präsent zu sein. Darum muss dringend die Mobilisierungskraft und die Kampagnenfähigkeit so ausgebaut werden, dass es für SPD-Mitglieder wieder ganz normal wird in Bündnissen mitzuarbeiten und auch an Großdemonstrationen teilzunehmen. Linke Regierungsbündnisse anstreben – Große Koalition beenden: Linke Politik braucht auch linke Bündnisse zur Umsetzung. Dass sich linke Politik in Regierungsbündnissen mit den konservativen Parteien nicht bzw. nur in winzigen Schritten umsetzen lässt, hat sich dabei in den letzten drei Großen Koalitionen seit 2005 gezeigt. Die damit einhergehenden Kompromisse waren oft so weit von einer sozialdemokratischen -geschweige denn sozialistischen Politik -entfernt, dass viele Menschen in diesen Jahren der Sozialdemokratie den Rücken gekehrt haben. Ebenso hat sich durch die nicht mehr deutlich werdenden Unterschiede zwischen der Sozialdemokratie und den Konservativen auch ein Feld für rechtsradikale Gruppierungen wie die AfD eröffnet. Für uns ist klar, dass es die SPD in den nächsten Jahren dringend als tonangebende, linke Kraft in der Bundesrepublik braucht, die entweder gemeinsam mit Linkspartei und Grünen eine fortschrittliche Links-Regierung oder mit zivilgesellschaftlichen Organisationen aus der Opposition heraus den Kampf für eine fortschrittliche Politik anführt. Denn gemeinsam mit den Gewerkschaften, Sozialverbänden und neuen sozialen Bewegungen ist die SPD aus der Opposition heraus ein starker Machtfaktor, der progressive Politik deutlich klarer vorantreiben kann, als in fortdauernden “Notbündnissen” mit den Konservativen. Deswegen muss die große Koalition umgehend beendet und zukünftig -womöglich-verhindert werden.